An der Verlegung von zwei Stolpersteinen vor der Tornquiststraße 44 für Elna und Tana Köhler haben sich am 17. November 2025 mehr als 60 Personen beteiligt. Ich denke, die meisten kamen aus der Straße selber. Das hat mich beeindruckt und spricht sicher für die Nachbarschaft.

Auf dem Treffen hatte eine Großnichte von Leser Conitzer aus der Tornquiststraße 9 teilgenommen und auch das Wort ergriffen. Er konnte 1939 mit seiner Partnerin noch nach Kapstadt fliehen.
Einige Tage vorher hatte ich eine Einladung in der gesamten Straße in einer Auflage von 200 Exemplaren verteilt und an verschiedene Einrichtungen vermailt.

Der Text war von der Geschichtswerkstatt Eimsbüttel und mir. Aus den Vorgesprächen über das Info war die Idee entstanden, weitere Bezüge zur Straße herzustellen, was sich im Info in der Wort niederschlug, dass ich in NS-Verfolgte in der Tornquiststraße 9 und 13 fanden, denen ihr Eigentum geraubt wurde. Aber auch weitere Hypotheken jüdische Menschen hatte ich gefunden. Dazu kam das Zwangsarbeitslager in der Schule Tornquiststraße 19 sowie der Einsatz von NS-Zwangsarbeitern, hier konkret italienischer Militärinternierte durch das Unternehmen Höpner, das ihren Sitz in der NS-Zeit in der Tornquiststraße 77 hatte. In der Tornquiststraße 47 fand ich ein „Fröbelheim“, dass die Nazis 1939 übernahmen.
Erst im Juli 2025 hatte ich zu den beiden NS-Opfern, Elna und Tana Köhler, in den Häusern um die Tornquiststraße 44 eine Info verteilt. Dabei ging es auch um die Frage nach einer Patenschaft. Ich war kaum aus der Tür, da hatten sich Menschen gefunden.
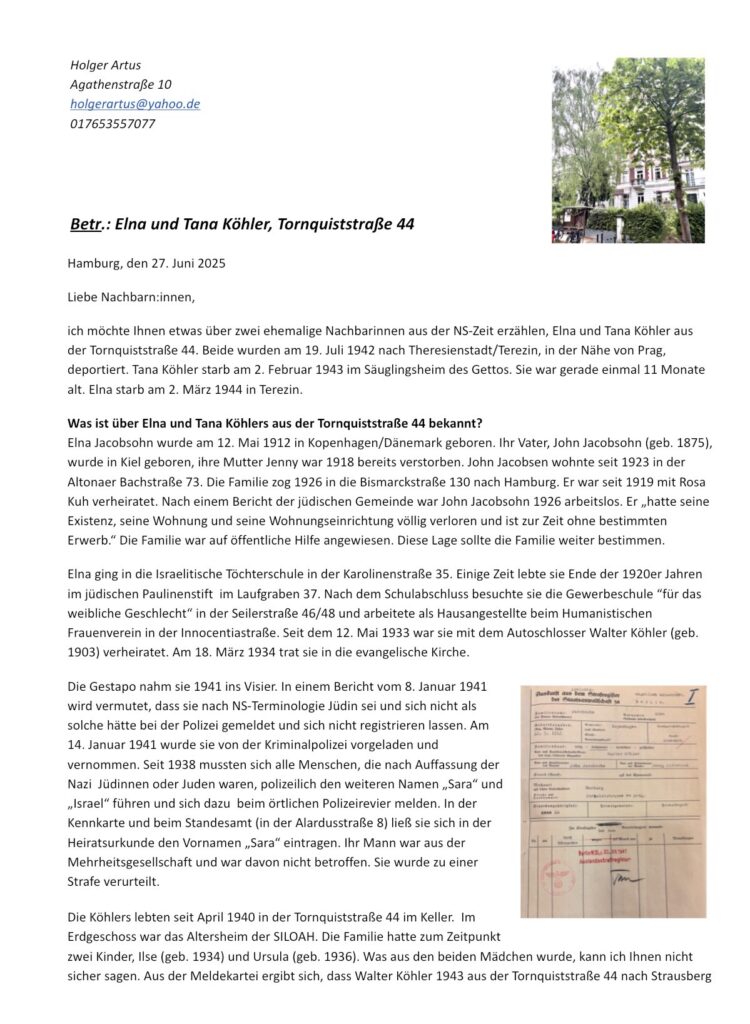
Zusagen noch einhalten
Bei drei Nachbarn stehe ich noch im Wort, da ich ihnen weitere Unterlagen zugesagt hatte. Mit der Großnichte von Leser Conitzer werde ich wohl auch noch in Kontakt bleiben.
Das so viele Menschen der Einladung gefolgt sind, ist ein gutes Zeichen: Die Erinnerung an NS-Opfern hat noch einen hohen Stellenwert. Das hat zentral mit den Stolpersteinen selber zu tun. Sie haben einen hohen Wert für die Erinnerung. Im Dezember 2024 war auch eine größere Gruppen von Menschen aus der Nachbarschaft um die Bellealliancestraße 66 zur Stolperstein-Verlegung gekommen. Genauso in der Stiftstraße oder Thadenstraße.
So sehr die Durchführung eines solchen Treffens zur Übergabe von Stolpersteinen für mich eine gewisse Routine hat, so ist jede Aktivität eine neue Herausforderung und immer anders. Am Ende ist man sehr aufgeregt, ob die Nachbarschaft kommt und ob man die richtige Ansprache getroffen hat.
Stolpersteine sind eine wichtige Form in der Erinnerungskultur
In der aktuellen Gedenkanstoß-Studie (2025) (MEMO-Studie) wurden Befragte gebeten, Projekte zur Aufarbeitung der NS-Verbrechen zu nennen.
Die Stolpersteine wurden von 13,4 % derjenigen Befragten genannt, die überhaupt mindestens ein solches Projekt kannten. Damit waren die Stolpersteine die am zweithäufigsten genannte Art von Aufarbeitungsprojekt (nach Gedenkstätten/Gedenkorten, die 40,3 % erreichten).
Wären Gedenkstätten oder Gedenkorte sich auf einzelne zentrale wie in Hamburg z.B. die KZ-Gedenkstätte beziehen, haben die Stolpersteine einen sehr hohen lokalen Bezug.
Die Akzeptanz für lokale Gedenkformen ist generell hoch: In der Gedenkanstoß-Studie (2025) stimmten 51,4 % (31,9 % eher dafür; 19,5 % absolut dafür) der Aussage zu, dass sie dafür wären, wenn in ihrer Straße eine Gedenktafel errichtet würde, die an NS-Opfer erinnert.
Mir signalisiert es, dass diese Form der Erinnerung in der eigenen Nachbarschaft noch weiteres Potential hat. Einmal wegen der Form selber, ein kleiner Stein im Gehweg und zum anderen wegen dem sehr hohen nachbarschaftlichen Bezug. Und es ist sehr niedrigschwellig politisch, was den Zugang auch erleichtert.
Wie könnte eine betriebliche Umsetzung aussehen?
Auf betriebliche Ebene suche ich seit Jahren den Zugang zur Erinnerungsarbeit. Die Stolpersteine sind in der Ansprache eine Zugangsform, in der betrieblichen Reflektion eher nicht. Dabei ist es so, dass die Unternehmensleitungen aus grundsätzlichen Überlegungen für das Thema aufgeschlossen sind und es aufgreifen.
Bei den betrieblichen Interessenvertretungen ist das eher schwer. In den Belegschaften dürfte die Propaganda der rechten Kräfte vorherrschend sein, dass man irgendwie mal einen „Schlussstrich“ ziehen müsse. Mittlerweile neige ich dazu, dass die betriebliche Übersetzung des Erinnerns an NS-Verbrechen für die betrieblichen und gewerkschaftlichen eine wichtige Aufgabe ist, um die nötige Lufthoheit betriebspolitisch im Kampf gegen rechts zu bekommen. Ich bin mir dabei natürlich bewusst, dass es entscheidend ist, dass man eine selbstbewusste und eigenständige Interessenvertretungsarbeit im Blick hat, also nicht den Stammtisch in seiner Arbeit bedient oder kriecherisch gegenüber dem Unternehmen sich nicht selber bestimmt.
Seit längeren beschäftige ich mit dem Thema, wie ein betrieblicher Ansatz aussehen könnte, so dass Potentiale in den Belegschaften erschlossen werden, so das größere Gruppen sich gewinnen lassen für konkrete Projekte. Es muss sie geben.

