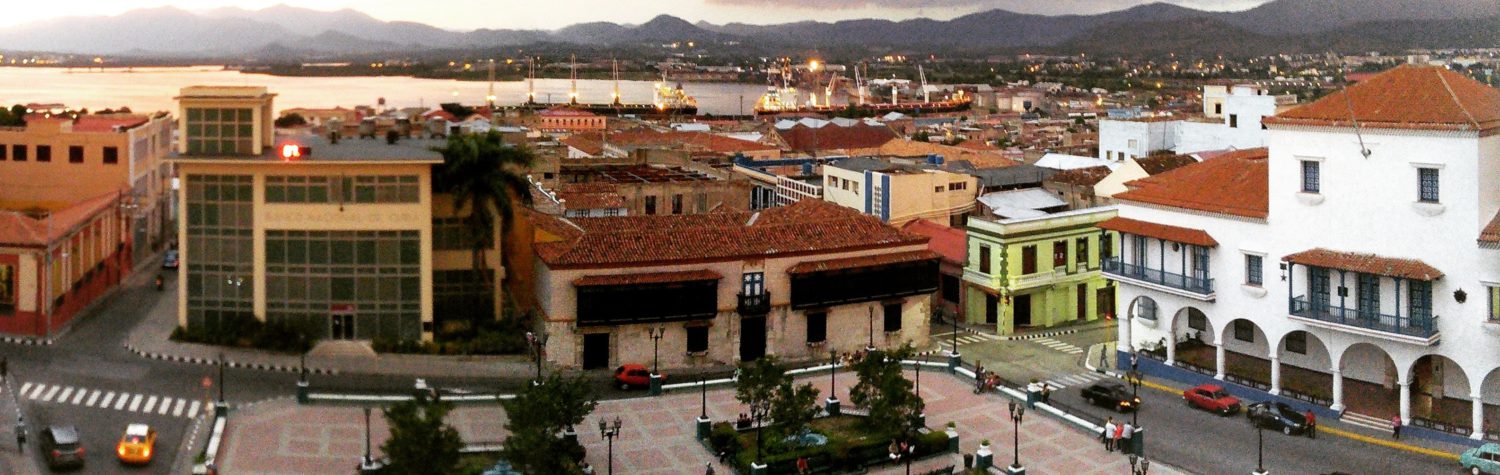Anlässlich des 20. Jahrestags des Streiks in der Sächsischen Zeitung 2019 habe ich an einer Broschüre mitgewirkt, die den Streik noch einmal nachzeichnet, den heutigen Stand für die Arbeitnehmer/innen und Fragen der Lehren aufgreift. Ein Versuch von mir, eine Debatte um die Virtualisierung der Arbeitsbeziehungen und die Industrialisierung redaktioneller Publikationsprozesse im Vorfeld einer Veranstaltung am 22. November 2019 anzuschieben scheiterte.
Meine Sichtweisen und Fragegestellungen zu diesem Thema werden in ver.di nicht geteilt, so dass keine/r die Debatten-Streit führen wollte, abgesehen von einer eher sinnlosen Twitter-.Debatte in diesem Jahr. Einige meiner Gedanken habe ich in der Broschüre niedergeschrieben, wenn auch zurückhaltend, da es ja eine ver.di-Broschüre ist.
Es gibt verschiedene Perspektiven, von denen man auf den dreiwöchigen Streik in Dresden blicken und seine Geschichte erzählen kann. Eine Frage ist, was von ihm bleibt, was seine Lehren sind.
Der Streik fiel in eine Zeit, als in anderen Zeitungsverlagen die Neuorganisation der Unternehmensabläufe bereits in vollem Gange war.
Betriebliche Streiks in Redaktion gibt es wenige
Während sich in Dresden die Beschäftigten gegen eine Erosion der Arbeitsbeziehungen wehrten, war es anderenorts üblich, es zu ertragen. Daran hat sich bei solchen grundlegenden Neuorganisationsprozessen in den Zeitungsverlagen bis heute wenig geändert. Man empört sich als Arbeitnehmer*innen-Vertretung, bleibt aber am Ende ohnmächtig und erschließt nur die betriebsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten. Der Arbeitgeber »beherrscht« die Köpfe im Unternehmen und die Prozess-Steuerung der Umorganisation. Mit seinen Schritten bestimmt er den Rückwärtsgang der Interessenvertretung, die nur über die Macht »verfügt«, mit dem Rücken an der Wand auf Gesetze zu verweisen. Die Gewerkschaften kommen heute immer mehr ins Spiel, da sie mit der Forderung nach einem Sozialtarifvertrag den Gestaltungsspielraum für die betriebliche Interessenvertretung erhöhen.
Journalistische Streiks gegen die Zerstörung bisheriger Regelungen gab es vor 1999 wenige und danach auch. In diesen grundlegenden Fragen der Arbeitsbeziehungen findet man sie vereinzelnd auf betrieblicher Ebene. Die zum Heinen-Verlag/DuMont Mediengruppe gehörige Rheinische Redaktionsgesellschaft streikte beispielsweise 2018 an neun Tagen und erreichte eine weitgehende Annäherung an die Flächentarifverträge. Die Streikaktivitäten in der Rheinzeitung 2004 richteten sich auch gegen einen Reorganisationsprozess. Es gab mehrere Streiktage und am Ende eine Vereinbarung über die Milderung finanzieller Härten für die vom Abbau betroffenen Beschäftigten aus der Redaktion und Druckerei.
Man muss über die Gründe unternehmerischen Entscheidungen reden
Immer erfolgen die Auseinandersetzungen vor einem konkreten Hintergrund, der in den genannten Fällen zum Streik führte. Aber es war und blieb eine lokale Auseinandersetzung. In der Magdeburger Volksstimme gab es 1997 den Versuch, die Redaktion in die Auseinandersetzung um die Durchsetzung des Flächentarifvertrages einzubeziehen. Nur knapp scheiterte die Urabstimmung. Die Drucker streikten fast vier Wochen und erreichten einen Haustarifvertrag, der im Wesentlichen den Flächentarifvertrag übernahm. Anlass war hier die Kürzung der Drucker-Gehälter und die Verschlechterung der Freizeitgestaltung bei der Abnahme freier Tage und Urlaub.
In Dresden ging es 1999 um die Verteidigung der Flächentarifbindung (über einen Haustarifvertrag). Die Gefahr bestand, dass sie aufgehoben würde. Im Ergebnis des Streiks konnte diese Bindung aber für die Redakteure*innen über zwei Jahrzehnte bis heute gesichert werden.
Interessenvertretungen suchten (und suchen) nach Erklärungen, weshalb das Unternehmen etwas verändern will, welche tatsächlichen Gründe es gibt, um darüber dann zu mobilisieren. Die Gewerkschaften verwiesen damals zum Beispiel wiederholt darauf: »Was im Osten ausprobiert wird, wird früher oder später auch den Westen erreichen«. Im Westen befand sich das Modell, wie die Zeitungsverlage sich neuorganisieren, bereits damals schon in der Umsetzung. Aber sehr wohl war dieses Argument (Ost-West-Problematik) ein richtiger Zugang zu den Belegschaften. Deren Identität zum eigenen Handeln spielt im Arbeitsalltag für die Potenzialerschließung um Marktanteile und Rendite für die Unternehmen eine entscheidende Rolle.
Der grundlegende Prozess, der sich in den 1990er-Jahren vollzogen hatte, war die Abkehr vom alten Modell der fordistischen Produktion hin zu einem flexiblen Modell unter finanzgetriebenen Rahmenbedingungen. Es hieß, dass die »Controller die Macht übernehmen«. Die Zeitungsverleger sprachen von einer besseren »Skarlierbarkeit«, was so viel bedeuten sollte, neue Umsätze in einer neuen Unternehmensorganisation zu generieren. Geringere Kosten sollten durch eine »flexible Organisation« erreicht werden. Gemeint waren Ausgliederungen, Zentralisierungen von Verlagsdienstleistungen und Personalabbau durch Zusammenlegungen von unternehmerischen Einheiten.
Man muss über die Gründe unternehmerischen Entscheidungen reden
Die Zeitungsgeschäfte von G + J in Berlin waren 1999 mit zunehmendem Einfluss des Internets und einer digitalen Welt durch Verluste geprägt und eine Sanierung stand auf der Tagesordnung. Die Hamburger Morgenpost war verkauft worden, um den Klotz am Bein loswerden zu können. Das Engagement für die kostenlosen Sonntagszeitungen wurde eingestellt und Anzeigenblätter auf die ergänzende Funktion für die beiden Abo-Titel reduziert, aber es war kein eigenständiges Geschäft mehr. G + J positionierte sich als regionales Abo-Zeitungstitelunternehmen, das auf dem Weg der strategischen Neuausrichtung war. Die G + J-Medienunternehmen in Dresden/Sachsen waren wirtschaftlich sehr erfolgreich und mit der neuen Unternehmensorganisation wollte man mit reduzierten Personalkosten und neuen regionalen Umsätzen die Rendite weiter steigern.
Es handelte sich hierbei um einen grundlegenden Prozess der Unternehmensorganisation, der im Wesentlichen alle regionalen Abo-Titel in West- und Ostdeutschland über ein Jahrzehnt lang erfasste. Es war kein spezifischer und alleiniger Ansatz von G + J. Damals schauten die Interessenvertretungen seitens der Moral und den Folgen für die Betroffenen auf das Geschehen, nicht aber von den Verteilungsprozessen (nach innen) und der Konkurrenzauseinandersetzung (nach außen) im Markt.
Es gab damals auch keine Ausrichtung in den Interessenvertretungen, dass man sich am Beginn einer völlig neuen Unternehmensorganisation befand. Schaut man von heute aus zurück, so kann man diese Schwäche u.a. daran sehen, dass sich die Tarifbindung der Redaktionen wesentlich verschlechtert hat. Noch deutlicher wird dies in den deutschen Druckereien. Nach Schließung größerer Betriebe und Standorte und dem damit verbundenen Wegfall wichtiger gewerkschaftlicher Stützen liegt heute die Tarifbindung dort bei unter 20 Prozent. Der Prozess der Neuorganisation mit vollzog sich ab Mitte/Ende der 1990er-Jahre. Doch diese Sichtweise auf die Umbruchprozesse als Ausgangspunkt für die dann im Allgemeinen folgenden gravierenden Veränderungen gab es damals nicht.
Erinnerung an Streik vor 20 Jahren hat was mit heute zu tun
Gegenwärtig findet wieder ein grundlegender Umbruchprozess statt. Reduziert man ihn auf die Gattung Abo-Zeitungen, so befindet man sich in der beginnenden Phase ihrer zukünftigen virtuellen Erscheinung bzw. innerhalb von Geschäftsprozessen, die nur im virtuellen Raum funktionieren werden. Die regionalen Boulevard-Titel sind bereits in einer Existenzkrise und werden in absehbarer Zeit physisch verschwinden. Wenn auch sehr langsam, wird die Konzentration der Abo-Titel zunehmen und einige ebenfalls in den kommenden Jahren verschwinden. Ein Beleg dafür ist der schleppende Verkaufsprozess der DuMont-Zeitungen: Dem Plan alles als Paket zu verkaufen, folgte der Versuch, sie einzeln zu veräußern. Der aktuelle Zick-Zack-Kurs der Funke-Mediengruppe, die sogar plante, die Berliner Morgenpost einzustellen, um ihr Zeitungsportfolio zu sanieren, spiegelt das genauso wider. Der Ansatz von Madsack, dass die Konsolidierung beendet sei, also keine anderen Zeitungen mehr gekauft werden, sondern dass man die digitalen Transformation gestalten muss/müsse, spricht ebenso davon.
Auf diese Situation, dass man sich historisch in einem digitalem Umbruchprozess mit all seinen Konsequenzen befindet, der die Zeitungen, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten künftig grundlegend verändern wird, darauf sollte sich eine Interessenvertretung strategisch neu ausrichten.
Wo geht die Reise der Mediengruppen hin? Wo wollen wir als Arbeitnehmer*innen-Vertretungen in den verschiedenen Phasen stehen?
Wie werden wir mit der Konsolidierung und Neuaufstellung ein Akteur, der in der Verteilungs- und Konkurrenzauseinandersetzung seine Möglichkeiten erschließt?
Es mag angesichts der grundlegenden Herausforderungen für die Printmedien merkwürdig klingen, aber am Ende geht es nur um eine Verteilungsfrage: Was bekomme ich von der Leistung der Beschäftigten? Sind diese organisiert und haben eine Auffassung von ihren Vorstellungen, werden sie wieder ein Faktor – auch in einer Umbruchphase.
Sie, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, weiter und wieder für die Interessenvertretungen zu gewinnen,
wird A und O bei der Durchsetzung gewerkschaftlicher Ziele sein. Dabei spielt immer schon auch der Solidaritätsgedanke eine große Rolle, der trotz ständig besserer Vernetzung im Alltagsdruck leider oft verlorenzugehen scheint. In und um Dresden spürte ihn damals jede und jeder Streikende und an dieses so wichtige Gut gilt es auch nach 20 Jahren noch zu erinnern.