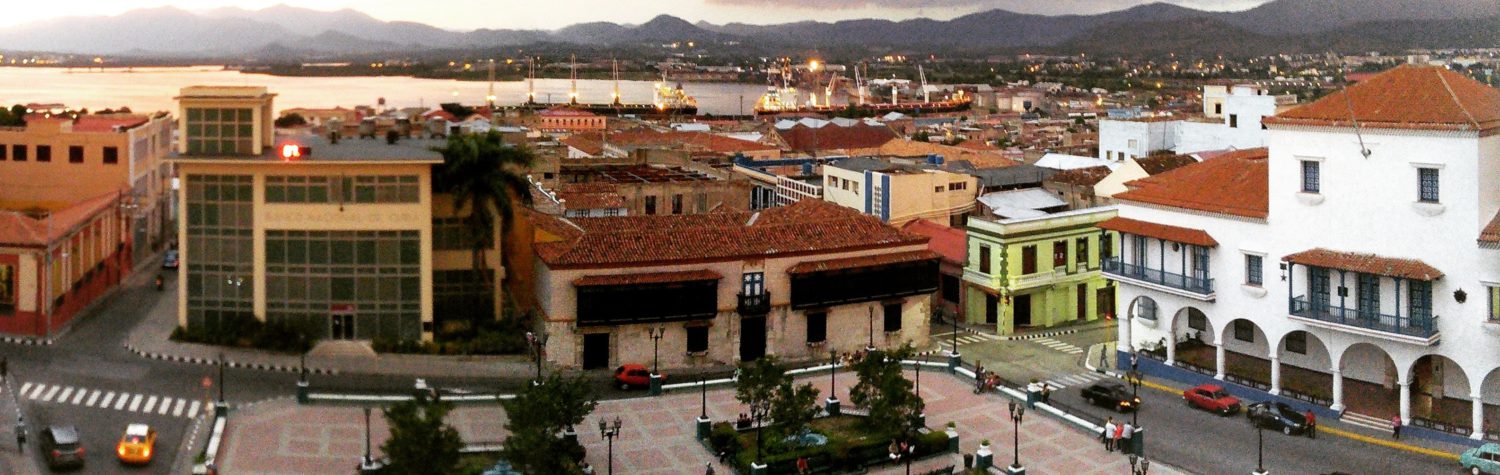Ich habe Googles KI „Notebook LM“ mit allen Betriebsratsinfos und Betriebsratsprotokollen aus 2006 gefüllt und eine Bewertung der Strategie erfragt. Es sind jeweils 38 Protokolle und 40 BR-Infos bzw. Redeskripte von Betriebsversammlungen. Die Auswertungen hatte ich im Rahmen einer aktuellen Recherche zur Übernahme der MOPO durch VSS/Mecom 2006 gemacht.
Ich hab die Protokolle und Betriebsratsinfos jeweils getrennt bewerten lassen. Es sind also zwei eigenständige „Notebook LM”. Soweit Namen meiner Kollegen:innen in der Bewertung aufgeführt wurden, habe ich die ausgelassen. Ansonsten ist es der Text der Maschine.
Meine damaligen „Strategiepapiere“ sind bei dem „Notebook“ nicht berücksichtigt worden. Sie sind aber in Teilen auf diesem Blog als eigenständige Texte zu finden, ob das Vorgehen zur Gründung des Konzernbetriebsrat, einem Europäischen Betriebsrat oder die Web-Strategie.
Und hier das Ergebnis, was mich natürlich sehr befriedigend erscheint, weil es unsere damals geplante Strategie in derUmsetzung m.E. im Herangehen gut beschreibt:
Die Strategie des BR wird zusammenfassend beschrieben. Sie
- war konfrontativ, identitätsbewusst und stark vernetzt.
- wird als sehr professionell, militant und strategisch klug bewertet
- Der BR verfolgte eine hochengagierte und methodische Strategie
- Der BR agierte realistisch
BETRIEBSRATS-INFORMATIONEN 2006
Die Strategie des Betriebsrats (BR) der Hamburger Morgenpost (MOPO) angesichts des Verkaufs an die Finanzinvestoren Veronis Suhler Stevenson (VSS) und Mecom 2006 war konfrontativ, identitätsbewusst und stark vernetzt.
Die Bewertung der Strategie lässt sich anhand der vorliegenden Dokumente wie folgt strukturieren:
I. Grundhaltung und zentrale Zielsetzung
Die strategische Ausrichtung des BR war von Anfang an durch eine realistische Einschätzung der Bedrohungslage und gleichzeitig durch einen selbstbewussten Widerstand gekennzeichnet
Bewertungspunkt | Details und Belege
Klare Zieldefinition
Das Hauptziel war der Erhalt der MOPO als Vollredaktion und selbstständiger Verlag am Standort Hamburg. Dies wurde als Sicherung der Arbeitsplätze und der journalistischen Identität betrachtet.
Realistische Bedrohungsanalyse
Der BR erkannte frühzeitig, dass die Investoren auf eine Wertsteigerung durch Renditeerwartungen (ca. 20 % EBITDA) und einen späteren gewinnbringenden Wiederverkauf in 5 bis 8 Jahren abzielten. Man wusste, dass das Ziel der Ergebnisverbesserung primär über die Kosten (insbesondere Personalkosten) erreicht werden sollte, da der deutsche Zeitungsmarkt kein Wachstumsmarkt war.
Selbstbewusste Verhandlungsgrundlage
Der BR stützte seinen Widerstand auf die wirtschaftliche Stabilität der MOPO (über 1 Mio. € Jahresüberschuss in den Vorjahren, 1,3 Mio. € für 2005/2006). Dies diente als Argument, dass es keinen wirtschaftlichen Grund für betriebsbedingte Kündigungen gab.
Fokus auf lokale Identität
Die Betonung der MOPO als „Unikat“ und „ein Stück Hamburg“ war ein zentrales Element der Strategie, um Zentralisierungspläne abzuwehren. Man verwies auf historische Misserfolge unter G+J, als versucht wurde, überregionale Inhalte aus Berlin zu beziehen.
II. Abwehrstrategien gegen Zentralisierung und Synergien
Die Strategie konzentrierte sich stark darauf, die Integration in die Berliner Holding-Strukturen zu verhindern, da dies als Hauptquelle für den Personalabbau und den Verlust der Selbstständigkeit angesehen wurde.
| Bewertungspunkt | Details und Belege
Konsequente Ablehnung der Zentralisierung
Der BR wehrte sich gegen die Pläne, die MOPO zu einem „Filialbetrieb“ der BV Deutsche Zeitungsholding zu machen. Konkrete Angriffspunkte waren die Zentralisierung der Finanzbuchhaltung und die Planung, den Server für das neue Anzeigensystem (Funkinform) in Berlin zu stationieren.
Verzicht auf lokale Kontrolle abgelehnt
Der BR forderte im Gegenzug die eigenständige Einführung eines modernen Anzeigen- und Redaktionssystems am Standort Hamburg durch die eigene IT-Truppe.
Kritik an redaktionellen Synergien
Die Strategie umfasste die massive Kritik an der Einführung der Mantellieferung (Panorama- und Nachrichtenseiten) aus Berlin (ab Okt. 2006). Der BR stellte fest, dass die MOPO zusätzliche Kosten für die Mantellieferung und die Anwesenheitszeiten der Berliner Führungskräfte kompensieren musste, was primär das Ergebnis des Berliner Kuriers verbesserte.
Harte Verhandlung bei Personalabbau
Die Strategie sah die konsequente Bekämpfung der ursprünglich geplanten 22 Stellenstreichungen vor. Man drohte mit dem Erzwingen eines Sozialplans im Falle von betriebsbedingten Kündigungen, wobei man betonte, dass dieser nur über die Höhe der Abfindung (z. B. 0,4 Gehälter pro Beschäftigungsjahr) sprechen würde, nicht über die Arbeitsplatzsicherheit selbst.
Proaktive Nutzung neuer Projekte
Die Einführung der „MOPO am Sonntag“ (MOPS) wurde zwar als unternehmerische Entscheidung hingenommen, aber strategisch genutzt, um Kompensationsforderungen (Prämien) und die Einhaltung tariflicher Freizeitregelungen (7-Tage-Produktion ohne ausreichende Personalaufstockung) durchzusetzen.
III. Offensive, Mobilisierung und Vernetzung
Der BR setzte auf Transparenz, interne Geschlossenheit und externe Allianzen, um den Druck auf die Gesellschafter und die Geschäftsführung zu erhöhen.
| Bewertungspunkt | Details und Belege
Interne Mobilisierung
Die hohe Wahlbeteiligung von 75 % bei den BR-Wahlen 2006 diente als Beleg für den starken Rückhalt der Belegschaft. Der BR betonte, dass der größte Hebel im Zusammenhalt von Verlag und Redaktion lag.
Konzernweite Kooperation
Der BR initiierte und trieb die Gründung eines Konzernbetriebsrats (KBR) der BV Deutsche Zeitungsholding voran, um konzernweit Einfluss zu nehmen. Der MOPO BR-Vorsitzende wurde stellvertretender KBR-Vorsitzender. Es bestand eine enge Solidarität und Kooperation mit den Betriebsräten des Berliner Verlages.
Internationale Vernetzung
Die Ausweitung der Strategie auf die internationale Ebene war bemerkenswert. Es gab Kontakte und Solidaritätsadressen von Betriebsräten der Mecom Europe Gruppe (Norwegen, Niederlande, Dänemark).
Öffentliche Konfrontation
Der BR nutzte Betriebsversammlungen, um David Montgomery und Peter Skulimma öffentlich einzuladen und ihr Fernbleiben als Zeichen schlechter Pläne oder Feigheit zu interpretieren. Es wurden klare Resolutionen („Jetzt reicht’s“) und Offene Briefe verfasst, um die Öffentlichkeit und die Belegschaft zu informieren.
IV. Bewertung der Strategie (Erfolge und Herausforderungen)
Die Strategie des BR wird als sehr professionell, militant und strategisch klug bewertet, da sie auf die spezifischen Schwachstellen eines Finanzinvestors (Angst vor schlechter Presse und operativem Widerstand) abzielte.
Erfolge (Mitigation und Regelwerke):
Mitigation von Kündigungen:
Die ursprüngliche Planung von 22 Stellenabbau konnte nicht vollständig verhindert werden, aber die Bedrohung wurde verzögert und in den schreibenden Redaktionen (Zeitverträge) durch hartes Verhandeln zumindest vorläufig abgemildert (Verlängerungen bis Ende 2007, teilweise mit Entfristungsoption in der Zukunft).
Technologie-Mitbestimmung:
Es gelang die Aushandlung einer Betriebsvereinbarung für das Anzeigensystem DIALOG von Funkinform, die den Schutz der Anwender vor technischer Überwachung und die Kontrollrechte des BR sicherstellte.
Stärkung der Ausbildung:
Die Anzahl der Volontärsstellen konnte erhöht werden, was ein positives Signal für die redaktionelle Zukunft war.
Transparenz und Druck:
Die Strategie, die Gesellschafter öffentlich zu konfrontieren und die finanziellen Motive (Luxemburg-Holding, LBO-Finanzierung) transparent zu machen, setzte die Geschäftsleitung unter Druck.
Herausforderungen und Grenzen:
Zentralisierung und Identitätsverlust:
Trotz des Widerstands konnte die Zentralisierung redaktioneller Leistungen (Mantellieferung aus Berlin) nicht verhindert werden. Die geplante Stellenreduzierung in produktionsnahen Bereichen (Archiv, Korrektur, Belichtungssteuerung) blieb weiter auf der Tagesordnung, da sie als „politische Entscheidung“ und nicht als technisch zwingend angesehen wurde.
Renditevorgaben als unüberwindbares Hindernis:
Die klaren Renditevorgaben der Investoren (Steigerung auf über 20 % EBITDA) blieben das dominante Problem m. Versuche des BR, Gelder aus umstrittenen Projekten (z. B. Readerscan) zur Personalaufstockung zu nutzen, wurden abgelehnt, da diese Mittel dem Ergebnis der Gesellschafter zugutekommen sollten.
Belastung der Belegschaft:
Die erfolgreiche Einführung der MOPO am Sonntag wurde durch die Tatsache getrübt, dass die zusätzliche Belastung hauptsächlich auf Kosten des bestehenden Personals ging, da eine ausreichende Aufstockung ausblieb.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der BR eine hochengagierte und methodische Strategie verfolgte, die interne Stärke mit externer Vernetzung verband, um die Konsequenzen der Übernahme durch Finanzinvestoren abzumildern und die Identität der MOPO zu verteidigen. Sie agierten realistisch („ohne Illusionen“) und nutzten alle ihnen zur Verfügung stehenden betriebs- und tarifrechtlichen sowie öffentlichen Mittel. Sie erzielten wichtige Teilerfolge, insbesondere im Bereich der Abmilderung des Personalabbaus und der Regelung von technischen Systemen, konnten jedoch die grundlegende, renditegetriebene Umstrukturierung und Zentralisierung der Holding nur bedingt aufhalten.
BETRIEBSRATS-PROTOKOLLE 2006
Die Dokumente beschreiben die Grundsätze und zentralen Rollen des Betriebsrats (BR) detailliert, insbesondere in der Zeit des fundamentalen Umbruchs durch den Gesellschafterwechsel 2006.
Die Grundsätze des Betriebsrats lassen sich in strategische, operative und soziale Kernrollen unterteilen:
1. Strategisches Mandat und Grundhaltung
Das übergeordnete Ziel des Betriebsrats in dieser Phase war es, nicht nur zu reagieren, sondern die Zukunft des Standorts und die Interessen der Belegschaft aktiv zu gestalten. Angesichts der unklaren Absichten der neuen Eigentümer war reines Abwarten keine Option; stattdessen ergriff der BR die Initiative, um die Bedingungen selbst zu definieren und die Interessen der Belegschaft offensiv zu vertreten.
Kernprinzipien der strategischen Arbeit waren:
Langfristige Sicherung der Interessen:
Der BR sollte strategisch agieren, um die Interessen der Belegschaft langfristig zu sichern.
Standortsicherung als oberste Priorität: Die Sicherung von Arbeitsplätzen und des Standorts Hamburg war die oberste strategische Priorität. Dazu wurde ein eigener, detaillierter „Vorschlag zur Standort- und Beschäftigungssicherung“ nach § 92a BetrVG erarbeitet.
Offensive Vertretung:
Zur Untermauerung der Forderungen wurden Aktionen organisiert, wie eine Unterschriften-Aktion und ein “Offener Brief” an den Aufsichtsratsvorsitzenden David Montgomery.
2. Rolle als Wächter und Gestalter
Der Betriebsrat sah sich in vielfältigen Rollen, die von der Überwachung, der Einhaltung von Vorschriften bis zur aktiven Mitgestaltung von Prozessen reichten.
Personalangelegenheiten (Der Mensch im Mittelpunkt)
Der BR fungiert als Wächter über gesetzliche und vertragliche Regelungen und als direkter Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Belegschaft.
Gesetzliche Mitbestimmung:
Bei nahezu allen personellen Veränderungen (Einstellungen, Versetzungen, Eingruppierungen) hat der BR nach § 99 BetrVG ein Beteiligungsrecht. Der BR achtete darauf, ordnungsgemäß beteiligt zu werden, auch wenn dies urlaubsbedingt zunächst versäumt wurde.
Schutz in Einzelfällen:
Eine wichtige Funktion zeigte sich in der engagierten Unterstützung einzelner Mitarbeiter in schwierigen Situationen. Beispiele hierfür sind der konsequente Einsatz für die Wiedereingliederung von NN nach dem „Hamburger Modell“ über Monate hinweg, inklusive der Forderung nach Kostenübernahme für technische Arbeitsgeräte, sowie die aktive Überwachung der Einkommenssicherung von NN, um finanzielle Einbußen zu verhindern.
Einhaltung von Absprachen:
Der BR drängte aktiv auf die Einhaltung von Absprachen, etwa bei der Sicherstellung einer Festanstellung für NN nach seinem Volontariat.
Einführung neuer Technologien
Der BR spielt eine Schlüsselrolle bei der Einführung neuer technischer Systeme.
Interessenswahrung und Gestaltung:
Die Aufgabe ist es, die Interessen der Beschäftigten zu wahren, Arbeitsabläufe mitzugestalten und sicherzustellen, dass Technologie dem Menschen dient und nicht umgekehrt.
Frühzeitige Beteiligung und Fachwissen:
Der BR strebte frühzeitige Beteiligung an und baute notwendiges Fachwissen auf, indem er Freistellungen für spezielle Seminare beschloss (z. B. zu Funkinform).
Datenschutz:
Besonderes Augenmerk lag auf dem Datenschutz, insbesondere bei der Einführung des Anzeigensystems „Funkinform“. Der BR achtete darauf, dass keine personenbezogenen Leistungsdaten übertragen werden und dass die Workflows keine heimliche Kontrolle der Mitarbeiter ermöglichen.
Arbeitsbedingungen und Compliance
Zu den fundamentalen Aufgaben gehört die Gestaltung fairer, sicherer und gesetzeskonformer Arbeitsbedingungen.
Einhaltung von Gesetzen und Tarifen:
Der BR achtete penibel darauf, dass Arbeitszeiten fair und im Einklang mit Gesetzen und Tarifverträgen geplant wurden. Bei der Planung neuer Produkte (z. B. der Sonntagszeitung) pochte der BR auf die strikte Einhaltung von Arbeitszeitgesetz und Tarifverträgen und forderte seine Mitbestimmungsrechte bei den Dienstplänen ein.
Vergütung und Transparenz:
Das Gremium fungierte als Kontrollinstanz bei Gehaltsfragen, forderte regelmäßig Einsicht in Gehalts- und Tantiemenlisten, um Transparenz sicherzustellen und überwachte der zügige Übernahme von Tarifabschlüssen (GTV).
Keine finanziellen Einbußen:
Der Grundsatz, dass es für keinen Arbeitnehmer finanzielle Einbußen geben darf, wurde im Zuge der Verhandlungen zur 7-Tage-Produktion (Sonntagszeitung) betont.
3. Vernetzung und Kommunikation
Ein Schlüsselfaktor für die langfristige Sicherung der Belegschaftsinteressen war die Vernetzung und Kooperation mit anderen Interessenvertretungen.
Gründung des Konzernbetriebsrats (KBR):
Die Gründung eines KBR auf Ebene der Dachgesellschaft (BV Deutsche Zeitungsholding) wurde als unumgänglicher strategischer Schritt angesehen, da isolierte Verhandlungen in Hamburg bei konzernweiten Entscheidungen ins Leere laufen würden. Ziel war die Bündelung der Kräfte und der Aufbau einer stärkeren und geeinten Verhandlungsposition.
Zusammenarbeit mit anderen Gremien:
Es gab eine enge Abstimmung mit den Gewerkschaften (ver.di & DJV) und eine wiederholte Abstimmung mit den Betriebsräten des Berliner Verlags, insbesondere bei der Einführung neuer Technologien (SAP, Anzeigensystem). Der BR unterstützte auch aktiv die Wahl eines Redaktionsbeirats und suchte den regelmäßigen Austausch.
Transparente Kommunikation:
Proaktive und transparente Kommunikation wurde als eine der wichtigsten Aufgaben angesehen, um Vertrauen zu schaffen, die Beschäftigten zu informieren und das Handeln des Gremiums zu legitimieren. Hierfür wurden nahezu wöchentlich schriftliche Mitteilungen („BR-Aktuell“ / „BR-Info“) genutzt und regelmäßig Betriebs- und Abteilungsversammlungen einberufen, um Themen direkt zu diskutieren. Außerdem wurde ein eigener Intranet-Auftritt mit klar definierten Kategorien angestrebt.
BETRIEBSVERSAMMLUNGEN 2006
Die Betriebsversammlungen (BV) der Hamburger Morgenpost (MOPO) im Jahr 2006 konzentrierten sich primär auf die weitreichenden Auswirkungen des Verkaufs des Verlages an die Finanzinvestoren Veronis Suhler Stevenson (VSS) und Mecom (unter der Dachgesellschaft Lux One).
Die zentralen Themen, die sich durch das Jahr zogen, waren die Sicherung der Arbeitsplätze, die Abwehr der Zentralisierungsbestrebungen aus Berlin, der Erhalt der MOPO als Vollredaktion und selbstständiger Verlag, sowie die Kritik an den hohen Renditeerwartungen der neuen Eigentümer.
Im Folgenden sind die Hauptthemen der wichtigsten bekannten Betriebsversammlungen des Jahres 2006 aufgeführt:
BV vom 30. Januar 2006
Kurz nach Bekanntwerden des Verkaufs standen folgende Fragen im Mittelpunkt der Versammlung.
- Die Bedeutung des Verkaufs der MOPO an die Finanzinvestoren-Gruppe für die Beschäftigten in Redaktion und Verlag.
- Die Sorge um neue Renditevorgaben durch die neuen Gesellschafter.
- Die Frage, ob es ab dem neuen Geschäftsjahr 2006/2007 zu redaktionellen Lieferungen aus Berlin kommen würde (wie von Aufsichtsratsmitglied Gerd Schulte-Hillen in Betracht gezogen).
- Die notwendige Investition in ein neues Anzeigen- und Redaktionssystem.
- Die Zusage der Geschäftsleitung, dass mit der Einführung eines neuen Systems keine Arbeitsplätze abgebaut werden.
BV vom 21. April 2006
Drei Monate nach dem Verkauf standen die unklare Strategie der neuen Eigentümer und die Bedrohung der Eigenständigkeit im Vordergrund:
- Die Forderung nach der Sicherung des Standorts MOPO in der Griegstraße als Vollredaktion und selbstständiger Verlag .
- Kritik am Fernbleiben der Investoren (David Montgomery, Peter Skulimma, Marco Sodi und Gerd Schulte-Hillen), die trotz Einladung nicht vor der gesamten Belegschaft erschienen waren. Dieses Verhalten wurde als Indiz für „schlechte Pläne“ interpretiert.
- Die Diskussion um das drohende Synergie-Szenario (Personalabbau und technische Zentralisierung), insbesondere im Hinblick auf bereits erfolgte betriebsbedingte Kündigungen in der Berliner Verlagsgruppe.
- Planungen für ein Rumpfgeschäftsjahr (1.7. bis 31.12.2006) mit dem Ziel einer gemeinsamen Planung ab dem 1.1.2007 zwischen Berlin und Hamburg.
- Die Einführung des Anzeigensystems Funkinform und die drohende Entwicklung der MOPO zu einem „Filialbetrieb“ der BV Deutsche Zeitungsholding durch zentrale Vorgaben aus Berlin (z.B. Server in Berlin, Abwicklung von Teilen der Finanzbuchhaltung und des Mahnwesens über Berlin).
BV vom 13. September 2006
Diese Versammlung befasste sich mit der beginnenden Umsetzung von Synergieplänen und der Einführung des neuen Sonntagsprodukts:
- Die Einführung der MOPO am Sonntag.
- Die Strategie der Finanzinvestoren, die auf Gewinnmitnahme über Berlin abzielte, wobei der Berliner Kurier Einnahmen durch die Lieferung des überregionalen Mantels und der Sonntagszeitung generieren sollte.
- Die Gefahr der Abschaffung von Ressorts (Vermischtes und vermutlich Service) in Hamburg, da diese Leistungen künftig aus Berlin bezogen werden sollten.
- Die Forderung des Betriebsrats nach einer fairen Umsetzung des Sonntagsprodukts und Einhaltung tariflicher Bedingungen: Die Sonntagszeitung – nur mit UNS!
BV vom 30. November 2006 und Fortsetzungen (Dezember 2006)
Im Spätherbst eskalierte die Debatte um die Personalplanung für die Folgejahre. Die Betriebsversammlung vom 30. November und deren Fortsetzungen am 6. und 13. Dezember behandelten:
- Die Stellenplanung für 2007/2008 vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung am 14. Dezember 2006.
- Der geplante Stellenabbau in den Bereichen Archiv (3), Belichtungssteuerung (2) und Korrektur (3) aufgrund der Einführung eines neuen Redaktionssystems.
- Die unsichere Zukunft und die Forderung nach Entfristung von Zeitverträgen (insbesondere jene, deren Verlängerung vom Erfolg der MOPO am Sonntag abhing).
- Die Zukunft der Volontärsstellen
- Kritik an der seit Oktober 2006 stattfindenden Mantellieferung aus Berlin (Panorama-Seiten kommen vom Berliner Kurier) und die Forderung, diese Seiten wieder in Hamburg zu produzieren, da die Leser eine andere Sprache sprechen als die Berliner Leser.
- Die Resolution „Jetzt reicht’s“ der Redaktion, in der sich die Belegschaft gegen Sparmaßnahmen aussprach, um die Qualität der MOPO zu sichern.
- Die Ablehnung des Betriebsratsvorschlags, geplante Mittel für das Marktforschungsprojekt „Readerscan“ zur Erhöhung des Personaletats zu verwenden.
- Die Diskussion über Solidaritätserklärungen von Betriebsräten der Mecom Europe (Norwegen, Niederlande, Flensburg), die ebenfalls die Gefährdung der journalistischen Qualität durch Synergie-Strategien befürchteten.
- Am 6. Dezember 2006 nahm Hans-Peter Buschheuer (Chefredakteur des Berliner Kuriers und der BV Deutsche Zeitungsholding) an der Fortsetzung der Betriebsversammlung teil. Am 13. Dezember 2006 sagte Peter Skulimma (Geschäftsführer der BV Deutsche Zeitungsholding) sein Kommen ab.