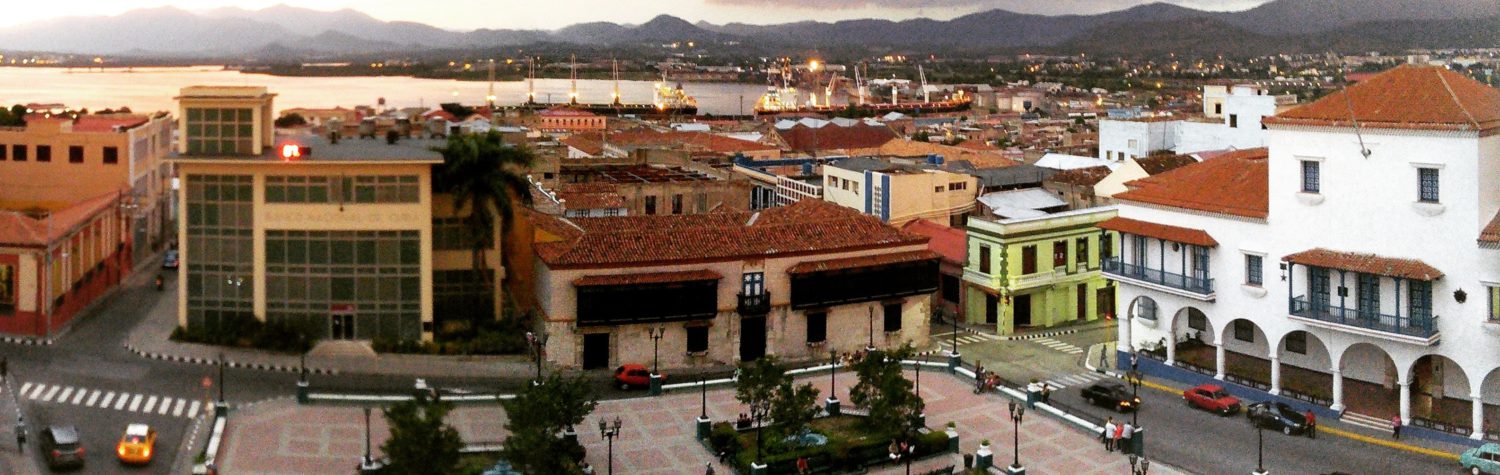27 Seiten umfasste das Strategiepapier des Betriebsrat vom Februar 2006, nach dem VSS/Mecom die MOPO Ende Januar 2006 gekauft hatten. Es ging im ihm um die Darstellung der Marktsituation, der Einschätzung der Ziele der Erwerbergruppe, deren Potentiale und unsere Ausgangslage als Beschäftigte.
Was wollen wir erreichen, was ist unsere Erzählung und wie organisieren wir uns?
Wie sollte unsere Gegenwehr aus, was wollten wir erreichen und welche Geschichte erzählen wir, wie sieht unsere Gegenpropaganda aus. Es entstand binnen zwei Wochen.

Bei der Frage, wie wir agieren und was wir erreichen wollen, gab es Wunschvorstellungen wie auch die Frage nach dem schlimmsten Fall. Für mich war (und ist) die Zuordnung zu den Fällen/Cases kein statistische Größe. Verändern sich die Bedingungen, muss man seine Ziele überprüfen. Zentral war, etwas als Ziel zu formulieren, was man erreichen will und nicht die Belegschaft täuscht. Wie oft habe ich Situationen erlebt, wo sich jemand hinstellte, dass Ergebnis von Verhandlungen lobte, egal wie Bitter die Pille für die Betroffenen war. Es war (und ist üblich), dass nach erst den Ergebnissen seine Kriterien formuliert, um jeden Mist schön reden zu können. Gerade in schweren Kämpfen, die mit enden, wird am Ende gesülzt, Hauptsache, man steht als Verhandler gut dar.
Wenn ich fast 20 Jahre später das Papier lese, empfinde ich es immer noch als ordentliches Papier. Heute würde ich noch konkreter sein, auch wenn es weitere Papiere danach gab, die das Vorgehen in Phasen unterteilte, Vorgehen korrigiert wurden, die nächsten Schritte formulierte sowie die dazu angesehenen Kriterien. So zur Gründung eines Konzernbetriebsrat 2006 und im gleichen Jahr zum Europäischen Betriebsrat oder zur Umsetzung der Web-Strategie.
Ziele ist mehr als „verhindern“ oder „durchsetzen“, wenn man sich formiert
Ich erinnere mich, wenn ich in der damaligen Zeit in der Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und Betriebsräten über Ziele und Wege sprach, die man vorher formulieren sollte, wurde ich mit großen Augen angesehen: „Verhindern“ oder „Durchsetzen“. Keine Lageeinschätzung, keine Potentialermittlung oder Losungen für die Mobilisierung. Öffentlichkeitsarbeit war kein Thema oder wurde als „bäh“ abgewiesen. Da ich auch andere Prozesse begleitet hatte, wusste ich, dass mein Vorgehen funktioniert und „erfolgreich“ war. „Ordnung, Ordnung, Ordnung – Handwerk, Handwerk, Handwerk“ waren meine Sätze, bevor es an die Planung ging. Wir hatten es mit Menschen zu tun, die uns vertrauen sollten und vertrauten.
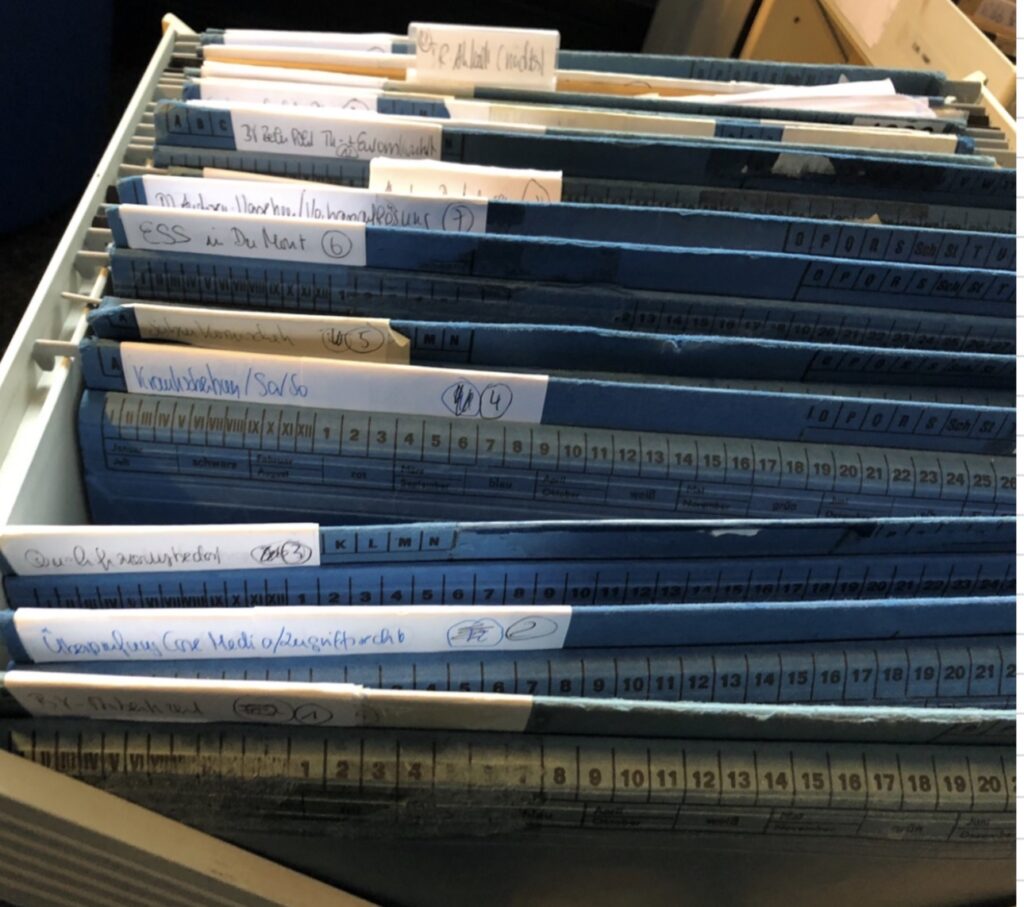
Gegenöffentlichkeit
Zersetzungsarbeit der Erzählung der Unternehmen war für Betriebsräte oder Gewerkschaftsvertreter in Auseinandersetzungem kein Thema, wurde als „bäh“ angesehen. Für mich gehört(e) es dazu, steht doch im Zentrum die eigene Erzählung. Es war und ist kein Spiel mit Eitelkeiten, es gehört technisch dazu. Das Papier spiegelte den damaligen Stand der Debatte wieder.
Ein Punkt wurde sehr zeitnah korrigiert. Die Fragestellung war schnell; „Welches Bild wollen wir von David Montgomery in der Öffentlichkeit zeichnen“ und welche Punkte sind das. Er war das schwache Glied unter den Gesellschaftern. Wir hatten uns vorgenommen, dass ab Beginn seines Wirkens wir ein Bild von ihm zeichnen, dass übernommen und von uns konsequent in der Kommunikation „bedient“ wird. Dazu gehörte, dass man sein Bild nicht mit dem „Sanierer“ verbindet und den Titeln, die ihm zugeschrieben wurden, sondern als einen, der immer wieder scheitert u.a.m.
Differenzen unter den Gesellschaftern treiben
Zur Wahrheit bei diesem Thema gehörte: Deren Kommunikationsagentur, Brunswick Group, trat so überheblich und arrogant uns gegenüber auf, dass ich keine kooperative Dialogstrategie nach dem ersten Kontakt mehr verfolgte. Es war für mich eine Steilvorlage, an welchen Punkt man seine eigene Erzählung aufbaut. Ich wusste: Das Grundziel, Differenzen unter Gesellschafter nach außen zu vermitteln, hatte bei so einem Verhalten eine gute Basis. Damit wurde nichts am Marktgeschehen verändert, aber Kräfteverhältnisse verschoben, da Glaubwürdigkeit fürs Handeln von Menschen eine große Rolle spielt.
Wissen um objektive Rahmenbedingungen?
Bei der Ausdifferenzierung der Ziele in der Debatte um sie, der Formulierung des Weges dorthin, der verschiedenen Facetten, gibt es natürlich Prioritäten. Mir wurde früher immer vorgehalten, wenn ich von „Lageeinschätzung“ sprach und damit die Rahmenbedingungen des Unternehmens meinte, dass das völliger Blödsinn. Was nütze mir dieses Wissen? Will ich den Arbeitgeber mit dem Wissen mit seinen Mitteln schlagen und ihm sagen, wie es besser gehen könnte (Nee)? Will ich den Markt verstehen, auf den ich kein Einfluss habe (Ja, aber habe deswegen keinen Einfluss auf den Markt)? Auch die Lageeinschätzung des „subjektiven“ Faktors war zentral, weil der sich ja verändert, wenn der Prozess sich vollzieht. Das passiert vor allem über die Kommunikation und die Praxis.
Ich habe konkrete Namen und Zahlen des Unternehmens im Papier gestrichen. Sie sind nicht von Belang. Streichungen sind mit …. gekennzeichnet. Sie sind unwesentlich und inhaltlich ohne Bedeutung.