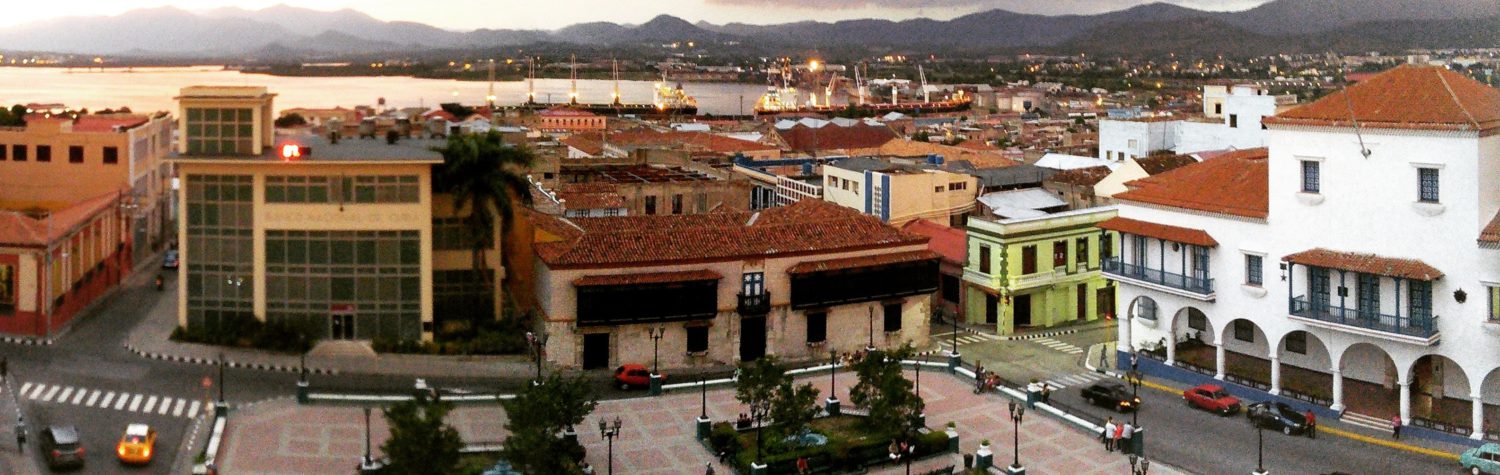Auch 2025 habe ich mich an den Aktivitäten zur Erinnerung an die italienischen Militärinternierten in Hamburg aktiv beteiligt. Seit 2020 findet jährlich um den 8. September in Hamburg etwas statt. Sie wurden als Zwangsarbeiter von Ende 1943 bis zur Befreiung am 3. Mai 1945 in Hamburger Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen eingesetzt.
Quantitativ Ziele erreicht
Die besprochenen quantitativen Zielsetzungen wurden in wesentlichen erreicht. Es gab drei Veranstaltungen am 4., 5. und 8. September 2025. Die definierten Zielgruppen sind gekommen, italienische Community um ANPI, lokale Akteure:innen aus Altona-Altstadt und Beschäftigte aus der Stadtreinigung. Für den 8. September 2025 hatten wir uns mehr Resonanz aus dem aktiven gewerkschaftliche Spektrum aus dem Unternehmen erhofft. Das bleibt nach wie vor eine generelle Herausforderung.
Der Besuch der ANEI aus Italien zu allen drei Veranstaltungen war finanziert und sie haben gute Reden gehalten. Mit 110 Teilnehmenden sind wir auf dem Niveau vom Vorjahr gewesen, mit dem Unterschied, dass wir sie diesmal alle selber organisiert hatten. Die Reden von zwei Angehörigen aus Hamburg waren besondere Momente, die so nicht geplant waren. Mit den beiden Erinnerungstafel am Sportplatz an der Max-Brauer-Allee und vor der Stadtreinigung am Bullerdeich wurden zwei weitere Gedenkorte in Hamburg geschafft.
Inhaltlich das Vorgenommene thematisiert
Inhaltlich wurden die Ziele ebenfalls erreicht. Das Thema der IMI in den Bau- und Arbeitsbataillonen wurde neu angegangen, zwar nicht ganz so ordentlich aufgearbeitet, wie ich mir das erhofft hatte, aber damit muss ich leben, da ich es selber nicht besser weiß. Es gab dazu zwei neue Webtexte in der Vorbereitung, die jeweils exklusiven Content hatten, so dass man im Netz jetzt mehr findet zu Hamburg und den BAB. Es bleibt zu wenig.
Recherche-Ergebnisse zur Stadtreinigung
Die Recherche zu den Zwangsarbeitenden bei der Stadtreinigung in der NS-Zeit war wieder sehr befriedigend. Mit diesem Umfang hatte ich nicht gerechnet. Insgesamt habe ich zur Thematik 19 Webtexte veröffentlicht, so dass es einen gewissen Überblick gibt, der auch im Netz steht. Es gab für mich einen gewissen Publikationsdruck, so dass ich in der Recherche nicht das Potential der Quellen erschlossen habe.
„Machbarkeitsstudie“ der FZH
Ich hatte mich sehr über die „Machbarkeitsstudie“ der FZH zur Stadtreinigung geärgert. Ursächlich haben nicht alle Akteure:innen über das gleiche gesprochen, sprich unsere Fragen floßen nicht in die Anlage der Studie ein. Ich hatte mich entsprechend gegenüber dem FZH vor längerem entsprechend geäußert. Ich bin froh, dass ich meinen Ärger in produktive Recherche umsetzten konnte.
Neben den unmittelbaren Ergebnissen meiner Recherche zu den Zwangsarbeitenden bei der Stadtreinigung konnte ich die Gründung des Aufräumungsamtes von Dezember 1943 bis April 1944 aufbröseln und das Verhältnis der Stadtreinigung zum Aufräumungsamt klären. Die Stadtreinigung hatte entgegen meiner bisherigen Auffassung nichts mit der Einsatzplanung der NS-Zwangsarbeiter:innen seit August 1944 zu tun. Dies war primär die Aufgabe des Aufräumungsamtes.
NotebookLM Projekt – aber alleiniger Nutzer
Sehr befriedigend war, dass ich alle Recherche-Ergebnisse in ein NotebookLM-Projekt importiert hatte, so dass man jede erdenkliche Frage stellen und Auswertungen fahren konnte (und kann). Eine meiner Fragen war eine Zusammenfassung, die ich dann der Stadtreinigung als Summary übergeben hatte. Einen Podcast aus den Texten halte ich für eine gute Arbeitshilfe, ohne dass man die Texte lesen musste. Das Angebot, meine Erkenntnisse mit anderen auszutauschen, scheiterte, da ich alleine daran interessiert war.
Abstimmung ist eine Herausforderung, die nicht jedem liegt
Mir geht es bei der Erinnerungsarbeit um eine Erzählung, die ich möglichst adressieren kann. So hatte ich in der Jarrestraße 62-70 eine Info zum ehemaligen Standort der Stadtreinigung und dem Einsatz von italienischen Militärinternierten in die Briefkästen der heutigen Nachbarschaft gesteckt. Am Standort der ehemaligen Müllverbrennungsanlage in der Ruhrstraße hatte ich mich an die Beschäftigten-Vertretung gewandt und sie über die Zwangsarbeit in der NS-Zeit an dem Standort informiert. Beide Texte kamen danach auf die Webseite. Bei der Planung der Info stimmte ich mit z.B. mit Geschichtswerkstätten ab und suche den Austausch mit meiner Gewerkschaft. Die Kontakte und Beteiligungen zielen auf die späterer Bewerbung, aber vor allem auf die mögliche Potentialerschließung bei künftigen Projekten, auf die man dann zurückgreifen könnte.
Eine weitere Erinnerungsaktivität wurde von anderen außerhalb des bisherigen Trägerkreises zu den IMI im Volksparkstadion geplant. Ich war damit nicht einverstanden und hatte es den Trägern dieser Aktivität gesagt. Vorherige Prozesse und besprochene Überlegungen wurden von ihnen einfach ignoriert. Bei der Planung einer Erinnerungstafel am Volksparkstadion zu den italienischen Militärinternierten ging es nach meiner Auffassung nur um die Tafel an sich, da noch Geld über war. Dafür war ich nicht zu haben. Das jetzt die Anbringung zum 8. September 2025 scheiterte, ist alles andere als befriedigend. Meine Erzählung zu den IMI im Volksparkstadion habe ich unabhängig von den Akteuren:innen vorher durchgezogen, meine Infos verteilt und mich um weitere Vernetzungen bemüht. Ich werde mit diesen Akteuren:innen nicht mehr zusammen arbeiten.
Ausdifferenzierung beim Thema der NS-Zwangsarbeit nimmt zu
Zu einem weiteren Fazit von mir gehört, dass die Ausdifferenzierung zum Thema NS-Zwangsarbeit weiter zunimmt und die Gemeinsamkeiten in der Erinnerungsarbeit abnehmen. Bestimmte Teile aus der Zivilgesellschaft nehmen nicht mehr an der Erinnerung an die IMI teil. In den Diskussionen geht es jetzt immer mehr darum, dass sie als italienische Soldaten eines faschistischen Staates an Kriegsverbrechen beteiligt waren und das man eher nicht als große Gruppe pauschal an sie erinnern kann. In der Tendenz setzt sich mehr der Ansatz von der „Einzelfall-Prüfung“ durch. Aber selbst die hat es schwer, da in Diskussionen die Verlegung eines Stolpersteins für einen italienischen Arbeiter, der im KZ ums Leben kam, in Frage gestellt wurde, ob mal für den einen Stolperstein verlegen sollte, da er als Arbeitsmigrant 1941 nach Deutschland kam. Auch wird argumentiert, dass andere NS-Opfer erst einmal einen Stolperstein bekommen sollten.
In der Diskussion um die kriegsgefangenen Arbeits- und Baubataillionen, die von der deutschen Wehrmacht aus IMI zusammengestellt wurde, ging es in einem Beitrag auch auf die Kriegsverbrechen der italienischen Soldaten in Albanien oder Griechenland. Ich sehe die Herausforderung, aber nach 80 Jahren das Thema nicht aufgearbeitet zu haben, wirkt bei mir irritierend, vor allem, wenn es um Experten geht.
Die von mir wahrgenommen Diskussion um die „wahren“ NS-Zwangsarbeiter:innen in der Zivilgesellschaft macht mir in dem Sinne zu schaffen, dass sie m.E. ein Zeichen dafür ist, dass es immer weniger gemeinsamen menschenrechtliche Auffassungen gibt, um die es in der Erinnerungsarbeit m.E. als gemeinsamer Nenner gehen sollte. Mein These ist bekanntlich, dass die Isolierung bestimmter Spektren zunimmt, so das provokative Positonen mehr und mehr vorgetragen werden. Sie können sich nur aus der Moral erklären, mit Analyse und Kriterien hat das nichts mehr zu tun.