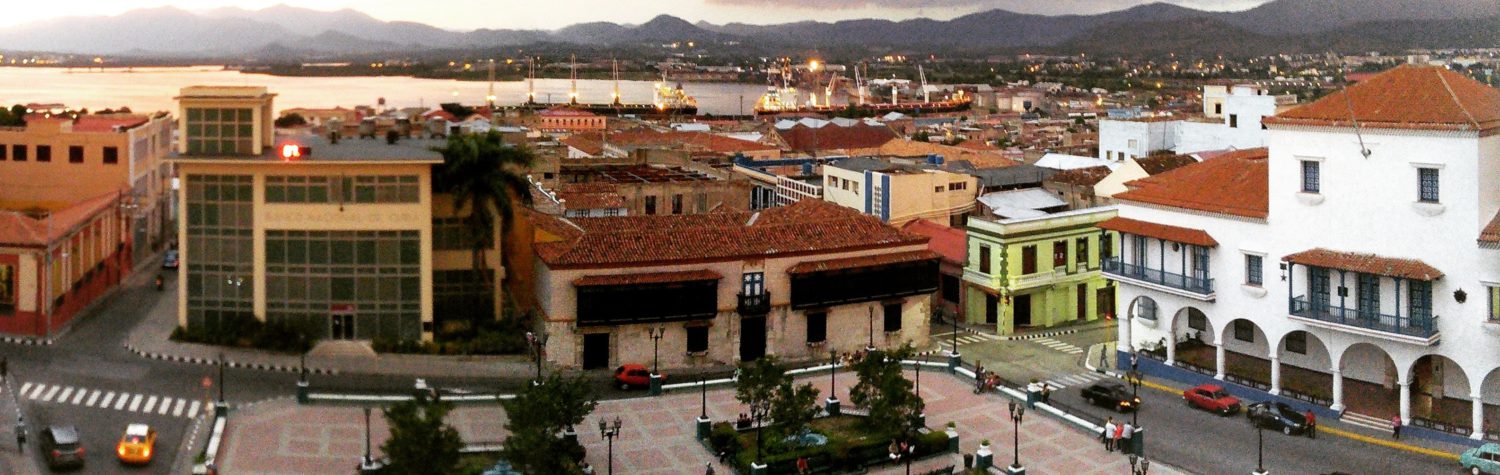Mit einer Kundgebung am 8. September 2025 vor der Hamburger Stadtreinigung ÄÖR am Bullerdeich 19 erinnern wir mit dem Unternehmen an die Zwangsarbeiter, die in der NS-Zeit von der damaligen Stadtreinigung eingesetzt worden. Die Haltung und Bereitschaft des Unternehmen, sich dem Thema zu stellen, beeindruckt mich.
Bei der Recherche zur inhaltlichen Aufarbeitung gibt es eine Vorstudie des FZH durch einen Historiker, um das Potential weiterer Nachforschungen. Ich selber habe eigenständig gewühlt und ich weiß noch von einer anderen Truppe, die sich mit dem Thema aus wirtschaftlichen Motiven beschäftigte. In der Vorstudie des FZH wird das Beispiel der jüdischen Familie Solmitz aufgeführt.
Jetzt habe ich mir den Vorgang noch einmal angesehen und einiges aufgeschrieben, allerdings weniger mit dem Blick auf die NS-Opfer, sondern der Rolle der Stadtreinigung in dem damaligen Prozess.
Die damalige Stadtreinigung in der Hamburger Bauverwaltung sorgte 1944 dafür, dass ihr ein einer jüdischen Familie geraubtes Grundstück als Müllabladeplatz überlassen wurde.
Die Sommerresidenz der Familie Solmitz in Groß Borstel
Ernst und Hedwig Solmitz besaßen in Groß Borstel, In den Marsch 17/19, ein 64.000 qm großes Grundstück. Ernst Solmitz war Bankier und Inhaber des Bankhauses Solmitz & Co. im Raboisen 103 (heute: Europapassage). 1895 hatte er die „Schrödersche Halbhufe“ als Sommerresidenz erworben.
Damals lag das Grundstück an der Borsteler Chaussee 294. Der größte Teil der Fläche war für eine Pferdezucht fremd verpachtet. Auf dem Grundstück der Familie Solmitz befanden sich ein Bauernhaus und ein dazugehöriges Wirtschaftsgebäude.

Nach dem Tod der Eltern erbten die drei Kinder – Robert (1894), Olga (1893) und Carl (1899) – das Grundstück. Daran beteiligt waren außerdem Evelyn Rossen (1/5) sowie Hans Blumenfeld und Margarete Plaut (jeweils 1/10).
Hertha Solmitz, die Partnerin von Robert, hatte schon zu Lebzeiten des Schwiegervaters einen großen Garten angelegt, schrieben Henry Krägenau und Traute Matthes-Walk auf der Webseite des Kommunal-Vereins von Groß Borstel 2010. „Sie pflanzte zahlreiche Obstbäume, Gemüse, Beeren und Schnittblumen. Daneben öffneten weitläufige, gepflegte Rasenflächen den Blick bis in die Landschaft nach Niendorf. Die Familie liebte es, dort Gesellschaften und Feste zu feiern. „Wenn es zu der Zeit nicht Hitler gegeben hätte, könnte man sagen, wir wären in einem kleinen Paradies aufgewachsen“, erinnerte sich Tochter Ursula (geb. 1927), die später in Kalifornien lebte.“
Verfolgung, Vertreibung und Flucht
Die Solmitz wurden – wie alle jüdischen Menschen – vom NS-Regime verfolgt. Ihr Eigentum wurde ihnen geraubt. Die Kinder von Hertha und Robert – Ursula (11 Jahre), Martin (8) und Ruth (6) – standen am 14. Dezember 1938 auf dem Bahnhof Altona, um mit einem Kindertransport nach England zu fliehen.
1941 gelang es Hertha und Robert, über das besetzte Frankreich via Spanien nach Portugal und von dort nach Amerika zu emigrieren. 1944 folgten ihnen die Töchter Ursula und Ruth aus England – jedoch ohne ihren Bruder Martin. Er nahm sich 1943 das Leben. Carl Solmitz emigrierte nach Australien, Olga wie ihr Bruder Robert in die USA.
Was wurde in der NS-Zeit aus dem Grundstück in Groß Borstel?
Nach der Emigration der Solmitz wurde am 25. November 1941 das Grundstück in das Eigentum des Deutschen Reiches „überführt“ und damit den Familien geraubt. Auch gegenüber den Blumenfeld und Plauts verfuhr man so, obwohl das selbst nach NS-Gesetz nicht möglich war, da sie amerikanische Staatsbürger waren.

Im August 1943 kaufte die Stadt Hamburg das Grundstück. Die Gebäude darauf waren 1942 und 1943 zerstört worden, 41.000 qm wurden verpachtet.
Was hat die Stadtreinigung damit zu tun?
Im Juli 1944 wandte sich die Stadtreinigung über die Bauverwaltung an das Liegenschaftsamt. Sie „benötige dringend einen Müllabladeplatz… Es handelt sich um ca. 20.000 qm.“ Nach Auffassung der Stadtreinigung sollte alles sehr schnell gehen: „Um die genannte Fläche schnellstens für den gebrauchten Zweck in Benutzung nehmen zu können, ist die Pachtung beabsichtigt.“

Da dies nicht so rasch wie gewünscht möglich war, ließ das Baurechtsamt in der Hamburger Bauverwaltung die Fläche kurzerhand beschlagnahmen. Die Stadtreinigung gehörte damals zum Aufräumungsamt, ebenfalls ein Amt in der Bauverwaltung.

Nach der Befreiung 1945 verweigerte sich die Stadtreinigung, das Grundstück freiwillig an die jüdischen Eigentümer zurückzugeben. Noch 1949 verfügte dasselbe Baurechtsamt, dass das Grundstück – gestützt auf dasselbe NS-Gesetz – „der Stadtreinigung auf unbestimmte Zeit“ überlassen werden müsse.

Erst 1951 entschied das Wiedergutmachungsamt, den ehemaligen Eigentümern, ihr Grundstück zurückzugeben. Doch die Stadtreinigung suchte weiter den Streit um die Nutzung als Müllplatz.