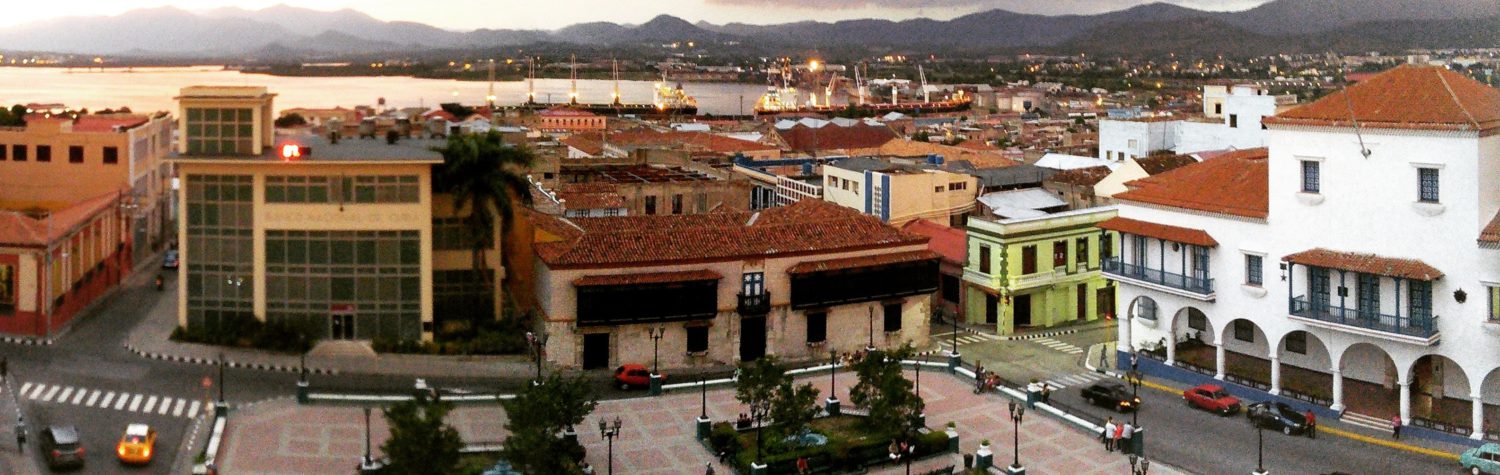Dieser Text entstand im Rahmen meiner Recherche zur Zwangsarbeit in der Stadtreinigung bis 1945. Ausgangspunkt waren die italienischen Militärinternierten, später kamen andere Opfergruppen dazu. Es dauerte sehr lange, bis ich die Unterscheidung zwischen Aufräumungsamt und Stadtreinigung begriff. Beide hatte ich in einem Topf geworfen. Ein Fehler.
Die Sintizze haben für das Aufräumungsamt auf einem Platz der Stadtreinigung gearbeitet. Da die Namen mir nicht bekannt sind, kann ich im konkreten Fall nicht sagen, für welche Baufirma sie arbeiten mussten. Insgesamt muss man bei der von mir ausgewerteten Periode von 12 Sint*zze ausgehen. Bei zwei Personen kenne ich die Namen, aber sie waren nicht auf einem Betriebshof der Stadtreinigung. Mit Blick auf die verschiedenen Opfergruppe habe ich die Sint*zze bewusst mitgenommen, weil sie als Minderheit von den Nazis vernichtet werden sollten und wir als Mehrheitsgesellschaft stark dazu neigen, ihre Verfolgung und Vernichtung aus dem Blick zu verlieren.
In der ehemaligen Müllverbrennungsanlage der Stadtreinigung in der Ruhrstraße (Kruppstraße) wurden Zwangsarbeiter:innen für Trümmerarbeiten eingesetzt. Zu ihnen gehörten auch Sintizze. Die Historikerin Anke Schulz verweist auf eine von ihr aufgeschriebene Erzählung über die Zwangsarbeit von Sintizze, die 1944 aus Polen flohen und nach Hamburg zurück kehrten, von wo sie im Mai 1940 nach Belzec deportiert wurden.
Anke Schulz spricht davon, dass die Frauen in der Müllverbrennungslage in der Kruppstraße/Ruhrstraße arbeiten mussten. „Die aufgegriffenen Männer mussten im Rahmen der Organisation Todt als Bauarbeiter im Bereich Stadionstraße / Luruper Hauptstraße Zwangsarbeit leisten, waren dabei in der Öffentlichkeit sichtbar, wie mir Luruper Zeitzeugen in den 1990er Jahren berichteten. Die Frauen mussten Zwangsarbeit in der Entsorgungswirtschaft leisten, so in der Müllverbrennungsanlage in der Kruppstraße (heute Ruhrstraße)…“

Hintergrund der Zwangsarbeit von Sinti*zze und Rom*nja ab 1944
Im Frühjahr 1944 begann die Gestapo, sich vom Arbeitsamt Hamburg, 1680 Namen von in Hamburg arbeiten Juden und Sint*zze zu besorgen und auszuwerten, um sie zur Zwangsarbeit einzusetzen. Das bedeutete, dass sie aus ihrer damaligen Beschäftigung entlassen wurden und im Auftrag des Aufräumungsamt einzusetzen. Insgesamt betraf das 1.080 Verfolgte, darunter 12 Sinti*zze.

Datenschutz-Einstellungen
Joseph W. und Christian S. hatten im Rahmen ihrer Entschädigungen für die Zwangssterilisationen im AK Altona in der Bülowstraße über den Arbeitszwang durch das Aufräumungsamt bzw. Arbeitsamt berichtet.
Zwangsarbeiter in der MVA Borsigstraße
In Hamburg gab es während der NS-Zeit zwei Müllverbrennungsanlagen: Einmal im „preussischen“ Altona in der Kruppstraße 49 – 55 (seit 1930 Ruhrstraße, Inbetriebnahme 1913, eingestellt 1961) und in Hamburg in der Borsigstraße 1 (Inbetriebnahme 1931, 1994 Ersatz der Anlage Borsigstraße durch Neubau Müllverwertungsanlage Borsigstraße MVB).
Vor Beginn des 2. Weltkrieges waren in den beiden Standorten 215 Menschen beschäftigt. Unmittelbar nach dem Überfall auf Polen wurden 42 Arbeiter zur Wehrmacht einberufen. Beide Verbrennungsanlagen wurden während des 2. Weltkriegs von Bomben getroffen und stellten zeitweilig ihren Betrieb ein.
In der Müllverbrennungsanlage Borsigstraße der Hamburger Stadtreinigung wurden einem Bericht vom Oktober 1944 der Hamburger Bauverwaltung 35 Zwangsarbeiter in der NS-Zeit eingesetzt.

Friederike Littmann sprich sogar von 60 Personen für die Borsigstraße und einem Zwangsarbeitslager auf dem Gelände der MVA. Zur Zeit sind keine Namen der Menschen bekannt, die als Zwangsarbeiter in der NS-Zeit dort arbeiten mussten.