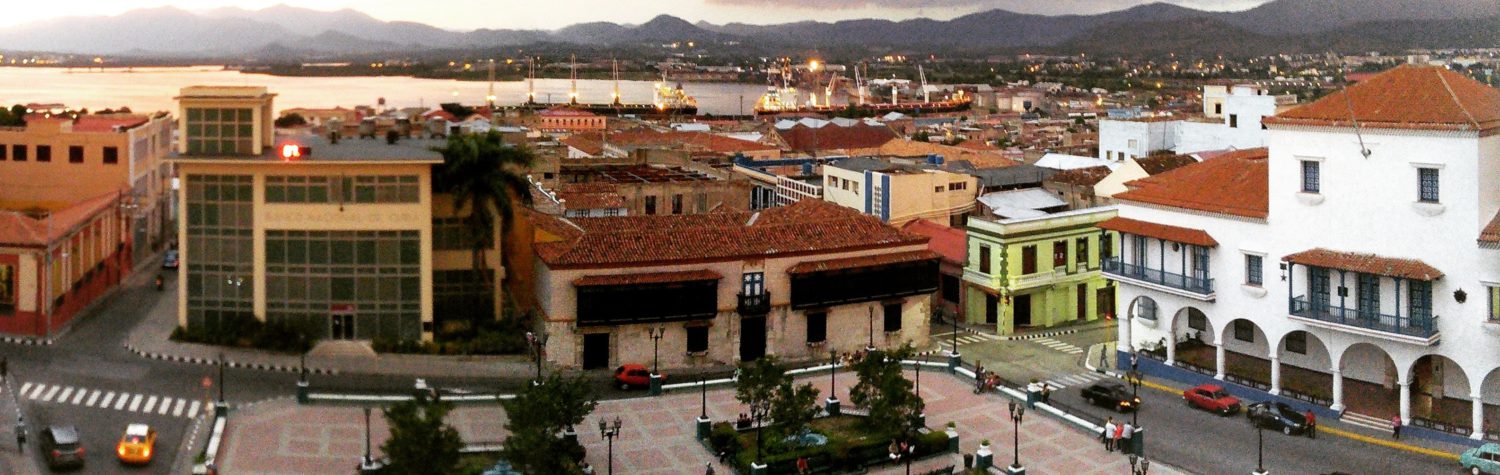Diese Info habe ich in die Briefkästen der heutigen Mieter:innen in der Jarrestraße 62 – 70 verteilt.

Von 1939 bis 1945 waren insgesamt 0,5 Millionen Zwangsarbeiter in unserer Stadt. Ohne sie wäre alles in Hamburg zusammengebrochen. Sie waren nicht freiwillig nach Hamburg gekommen. Es handelte sich um Kriegsgefangene oder Menschen, die aus ihrer Heimat nach Deutschland verschleppt wurden. Ihre Heimat war von der Wehrmacht besetzt und sie standen vor der Alternative, verfolgt zu werden oder in Deutschland zu arbeiten.
Für die Müllabfuhr und Straßenreinigung Hamburgs wurden ab 1943 Italienische Militärinternierte (IMI) als Zwangsarbeiter eingesetzt. In der Jarrestraße 66 waren 36 dieser IMI, die als „Müllarbeiter“ tätig waren. 18 IMI waren hier für die Straßenreinigung eingesetzt worden. Für die Schneebeseitigung waren bereits seit 1942 französische Kriegsgefangene tätig. In ganz Hamburg waren bis zu 1.500 französische Zwangsarbeiter in der Winterperiode für die Stadtreinigung verplant.

Bei der Stadtreinigung waren insgesamt 649 IMI an den verschiedenen Standorten des Unternehmens tätig. Die 54 hier in der Jarrestadt 66 kamen jeden Tag aus ihrem Barackenlager in der Trabrennbahn Farmsen. Das Zwangsarbeitslager der französischen Kriegsgefangenen – für die Straßenreinigung – war im Winterhuder Fährhaus.

Was war das mit den IMI?
Bei den Militärinternierten handelte es sich um italienische Soldaten, die nach dem Waffenstillstand zwischen den Alliierten und der neuen italienischen Regierung im September 1943 von der deutschen Wehrmacht gefangen genommen wurden. Viele italienische Soldaten legten nach dem Waffenstillstand ihre Waffen nieder und versuchten, nach Hause zu ihren Familien zurückzukehren. Auch sie gerieten ins Visier der Wehrmacht. Rund 650.000 von ihnen verweigerten den Befehl, weiterhin an der Seite der deutschen Armee zu kämpfen, und wurden als Zwangsarbeiter, vor allem nach Deutschland, verschleppt. Um sich nicht an internationale Konventionen zur Behandlung von Kriegsgefangenen halten zu müssen, deklarierte Nazi-Deutschland sie am 20. September 1943 zu „Militärinternierte“. Ende September 1943 kamen die ersten IMI nach Hamburg.
Zwangsarbeiter:innen waren überall im Stadtteil sichtbar
Die Zwangsarbeiter:innen waren in der NS-Zeit jeden Tag für die Nachbarschaft sichtbar. Tausende zogen jeden Tag durch die Straßen. In der Wäscherei Wilhelm Wulff in der Jarrestraße 52-58 mussten über 30 sowjetische Frauen sowie 12 Menschen aus den Niederlanden und Belgien. Am Kaemmererufer war das Stahlunternehmen Carl Spaeter mit über 100 Zwangsarbeitern. Die IMI von Spaeter kamen aus einem Lager im Stadtpark. In der Jarrestraße mussten Kriegsgefangene leben und ab 1943 italienische Militärinternierte. Bei Kampnagel arbeiteten 800 Zwangsarbeiter vor allem aus der Sowjetunion und IMI. Ihr Lager war vorne am Poßmoorweg. „Um die Ecke“, in der Barmbeker Straße 26, war ehemals eine KFZ-Werkstatt von Hugo Pfohe. Die IMI kamen ebenfalls im Stadtpark. Pfohe reparierte Kriegsfahrzeuge. Sie könnte aber auch links und rechts der Saarlandstraße jede Menge Zwangsarbeitslager finden oder Unternehmen, in den sie arbeiten mussten. Ob in der Semperstraße, der Schule in der Forsmannstraße u.a.