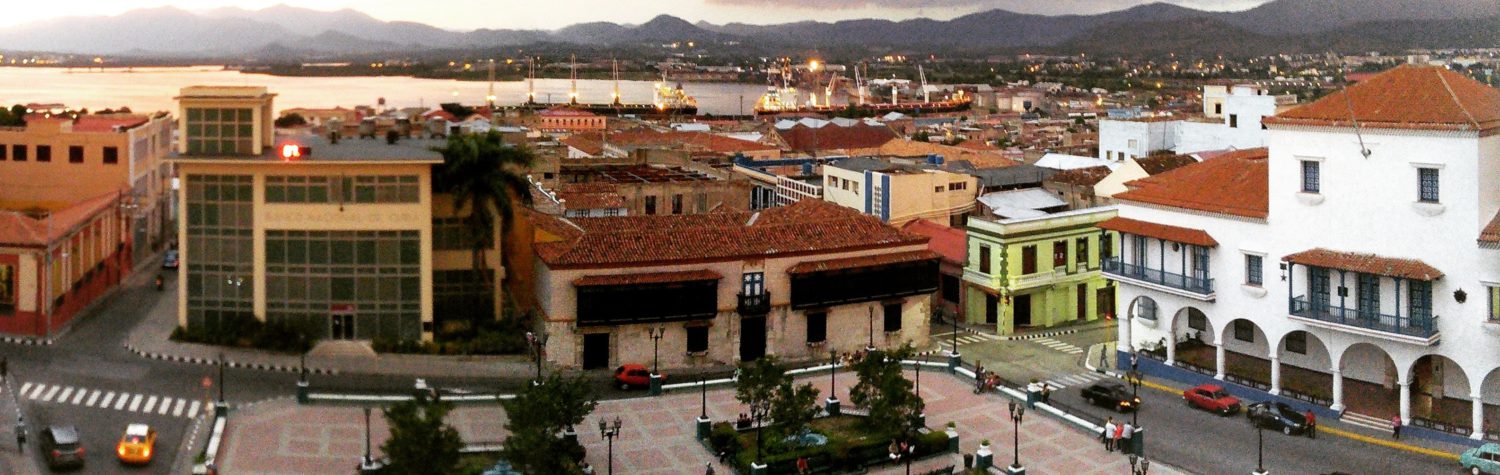Dieser Text war ein zufälliges Ergebnis meiner Recherchen zum Umfang der NS-Zwangsarbeit in der Stadtreinigung. Wie man schnell liest, habe ich wenig Ahnung von der Geschichte des Unternehmens am Beispiel derer historischen Standorts am Bullerdeich 6.
Ein Satz nach dem Bau eines „Gefangenen Lagers im Bullerdeich“ in einem Bericht der Bauverwaltung aus 1944 hat mich viel Zeit gekostet, da ich prüfte, ob es dabei um ein Lager in den Hamburger Gaswerken handelte. Aus der Systematik des Dokument muss es um die Stadtreinigung gehen. Bereits bei der Recherche zu einem Zwangsarbeitslager am Bullerdeich 2 hatte ich viele Schleifen gedreht, weil mir das Wissen um die Geschichte des Unternehmens, in dem Fall der Hamburger Wasserwerke, fehlte.
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs verfügte die Stadtreinigung Hamburg über 52 Lager- und Betriebsstätten. Nach den alliierten Luftangriffen ab Juli 1943 waren davon 29 vollständig zerstört und 11 beschädigt – das entsprach 67 Prozent der Betriebsstätten. Von den damals eingesetzten 85 Müllwagen wurden 56 (66 Prozent) zerstört.

In einem Bericht der Baubehörde vom August 1943 heißt es: „Die Stadtreinigung ist demnach durch die Angriffe am schwersten in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schwierigkeiten zeigten sich besonders bei der Müllabfuhr, die insbesondere auch wegen des katastrophalen Personalmangels nicht in der Lage ist, den […] anfallenden Müll ausreichend zu beseitigen.“

Rückgang der Müllwagen – Anstieg der Ochsengespanne
Im weiteren Kriegsverlauf verringerte sich der Bestand an Müllwagen kontinuierlich. Waren im Oktober 1943 noch 23 Fahrzeuge im Einsatz, so waren es im November 1944 nur noch 18 – und diese konnten aufgrund der eingeschränkten Gasversorgung nur teilweise betrieben werden.
Als Ersatz wurden zunehmend „bespannte“ Wagen mit Pferden und Ochsen eingesetzt. Das Berichtswesen über den Fuhrpark der Stadtreinigung passte sich dieser Entwicklung an: Regelmäßig wurde über die steigende Zahl eingesetzter Zugtiere informiert. Im Dezember 1944 meldeten die Verantwortlichen, dass die Zahl der eingesetzten Ochsen auf 313 erhöht worden sei.

„Operation Gomorrha“
Die sogenannten „Operation Gomorrha“ war eine direkte Folge des nationalsozialistischen Terrors und des deutschen Vernichtungskrieges. Zwischen dem 24. Juli und dem 3. August 1943 wurde Hamburg Ziel schwerer Luftangriffe alliierter Bomberverbände. In fünf Nächten griff die britische Royal Air Force vor allem Wohngebiete an, während die US-Luftwaffe in zwei Tagesangriffen das Hafengebiet und die dortige Rüstungsindustrie bombardierte. Insgesamt wurden rund 8.500 Tonnen Spreng- und Brandbomben über der Stadt abgeworfen.
Die Zerstörungen lassen sich heute relativ genau beziffern: Laut einer Statistik der Hamburger Bauverwaltung aus dem Jahr 1943 wurden unter anderem 277.330 Wohnungen, 580 Industriebetriebe, 24 Krankenhäuser und Kliniken sowie 58 Kirchen schwer beschädigt oder zerstört. Den verheerendsten Angriff flogen die britischen Luftstreitkräfte in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli mit mehr als 700 Bombern auf die östlich der Innenstadt gelegenen Stadtteile.
Bis heute finden die Stimmen der damals marginalisierten Menschen – etwa der Zwangsarbeiter:innen und KZ-Häftlinge – nur selten Gehör, obwohl sie nach den Angriffen mit der Bergung von Toten und der Entschärfung von Blindgängern beauftragt wurden. Das Tagebuch des italienischen Militärinternierten Marino Ruga, der bei den Hamburger Wasserwerken eingesetzt war, stellt eine seltene Erzählung aus dieser Perspektive dar. Die Initiative Dessauer Ufer bringt solche Erfahrungen in ihren Veranstaltungen in die Erinnerungskultur ein.
Kraftwagenwerkstatt Bullerdeich 6
Auf dem Gelände der ehemaligen Müllverbrennungsanstalt Bullerdeich befand sich eine Betriebsstätte der Stadtreinigung zur Instandhaltung der Kraftwagen. Dieser Standort am Bullerdeich 6 – oder alternativ der am Steinhauerdamm 17 – wurde im Sommer 1943 durch Luftangriffe beschädigt. Vor Kriegsbeginn waren in der Abteilung „Kraftwagenwerkstatt“ rund 80 Personen beschäftigt, die Müllwagen, Zugmaschinen und weitere LKWs der Stadtreinigung warteten.
Die genaue Anzahl der Werkstätten, ihre Standorte sowie die Zahl der Beschäftigten sind nicht vollständig bekannt. Es ist jedoch zu vermuten, dass Werkstätten auch an den anderen Müllverbrennungsanlagen in der Borsigstraße und der Ruhrstraße 43 bestanden.
Obwohl sich der Fuhrpark der Kraftwagenwerkstätten im Laufe des Krieges verkleinerte, nahm das Müllaufkommen – unter anderem infolge der Bombenschäden – deutlich zu. Um die Müllabfuhr, Straßenreinigung und Müllverbrennung sowie die Instandhaltung des verbleibenden Fuhrparks sicherzustellen, wurden Zwangsarbeiter eingesetzt.
Bau eines Gefangenenlagers am Bullerdeich 6
In den Monatsberichten der Hamburger Bauverwaltung an NSDAP-Gauleiter Karl Kaufmann ist von Instandsetzungsarbeiten auf verschiedenen Betriebshöfen die Rede. Im Bericht vom 10. Juni 1944 heißt es für den Monat Mai:“Die Bauarbeiten am Betriebsgebäude Norderstraße und am Gefangenenlager Bullerdeich werden fortgesetzt.“

Dabei dürfte es sich um das Gelände am Bullerdeich 6 gehandelt haben. Bisher wurden jedoch keine Unterlagen gefunden, die diese Annahme eindeutig bestätigen. Der Begriff „Gefangenenlager“ deutet auf ein Lager für Kriegsgefangene hin, die unter der Verantwortung der Wehrmacht standen.
Über diese Zwangsarbeiter sind heute kaum Namen oder nähere Umstände bekannt. Im Zuständigkeitsbereich der Hamburger Baubehörde befanden sich im Mai 1944 insgesamt 10.116 Kriegsgefangene und italienische Militärinternierte (IMI). Letztere wurden vom NS-Regime zu diesem Zeitpunkt sprachlich nicht mehr als Gefangene bezeichnet – eine bewusste Maßnahme zur ideologischen und rechtlichen Verschleierung ihres Status.
Müllverbrennungsanlage Bullerdeich, 1896–2025
Der Bau der Anlage am Bullerdeich begann im Jahr 1892, der Betrieb wurde 1896 aufgenommen. Es handelte sich um die erste Müllverbrennungsanlage auf dem europäischen Festland. Sie verfügte über 36 Ofenzellen, anfangs im Zwei‑, später im Dreischichtbetrieb. Da es keine Abgasreinigung oder Filter gab, kam es zu starker Flugascheverschmutzung.

Die Anlage wurde 1924 stillgelegt, nachdem Ersatzstandorte in Hamburg entstanden waren. 1931 ging die Müllverbrennungsanlage Borsigstraße in Betrieb. Mit der Stilllegung der Anlage am Bullerdeich endete die Ära der manuellen Müllverbrennung in Hamburg.
Auf dem ehemaligen Standort entstand später ein Recyclinghof der Stadtreinigung. Seit 2019 ist das Gelände Teil einer gemeinschaftlich und prozesshaft gestalteten Grünraum-Initiative. Das Projekt PARKS versteht sich als „ein gemeinschaftlich gestalteter und gepflegter Freiraum“, der in Kooperation mit lokalen Initiativen, dem Bezirksamt Hamburg-Mitte und der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) entstanden ist. Ziel ist es, Teile des Grünzugs gemeinschaftlich zu entwickeln. Bestehende Strukturen, lokale Flora und Fauna sowie vorhandene Nutzungen sollen gesichert und weiterentwickelt werden. PARKS steht dabei sowohl für ein Konzept als auch für einen konkreten Ort. Die Beteiligten sehen den Grünzug nicht als einheitliches Parkband, sondern als eine Reihe vielfältiger Freiräume.