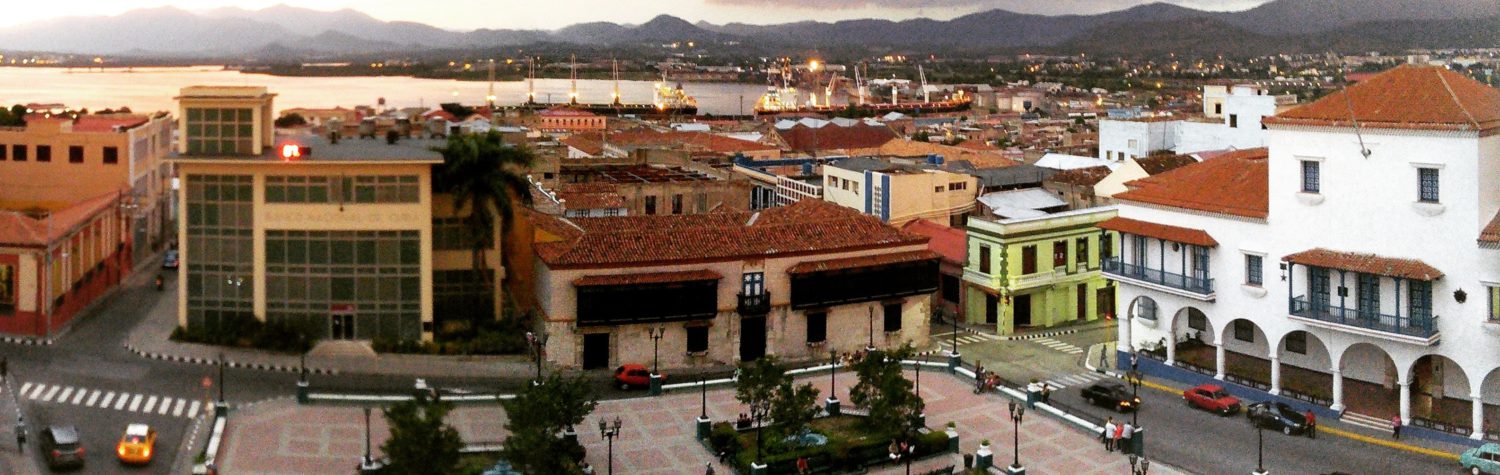Bei der Recherche zum Umfang der NS-Zwangsarbeit in der Stadtreinigung war ich zuerst von der falschen Annahme ausgegangen (Stadtreinigung=Aufräumungsamt), so dass ich mehrere Runden drehen musste, bevor ich etwas detaillierter die Fakten zur Stadtreinigung fand. Die ersten ausländischen Arbeiter, die ich an Hand von Dokumenten finden konnte, waren 40 Dänen.
Ob es sich bei ihnen um Zwangsarbeiter handelt, wird heute strittig diskutiert, weil sie nicht verschleppt wurden, sondern in Dänemark nach der Besetzung des Landes durch die Wehrmacht über das Arbeitsamt vermittelt wurden.
Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 begannen für die Hamburger Stadtreinigung in vielerlei Hinsicht erhebliche Probleme. Rückblickend vom 3. Mai 1945, dem Tag der Befreiung Hamburgs, erscheinen die Herausforderungen der Jahre 1939/1940 fast geringfügig. Hitlers Krieg führte zur weitgehenden Zerstörung der Stadt. Ohne den massenhaften Einsatz von Kriegsgefangenen, zivilen Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen wäre die öffentliche Infrastruktur Hamburgs nicht aufrechterhalten worden. Die Stadt wäre im Müll und unter Trümmern versunken.
Zwischen 1939 und 1945 waren etwa 500.000 Zwangsarbeiter:innen in Hamburg im Einsatz. Sie hielten Wirtschaft und Versorgung am Laufen. Ohne sie hätte die Stadt nicht mehr funktioniert. Ihr Einsatz war eines der sichtbarsten Verbrechen des NS-Regimes – und für alle Hamburger:innen unmittelbar erlebbar. Bis heute gibt es jedoch keinen öffentlichen Gedenkort, der die Dimension dieses Verbrechens angemessen sichtbar macht. Es ist der Zivilgesellschaft zu verdanken, dass überhaupt Erinnerungsorte in diesem Bereich bestehen.
Die Stadtreinigung – Teil des Tiefbauamts in der Hamburger Baubehörde
Ein Blick auf die Entwicklung der Hamburger Stadtreinigung ab 1939 zeigt exemplarisch, wie der Einsatz von Zwangsarbeiter:innen zunächst als Notlösung begann und sich schrittweise zu einem systematischen Bestandteil des nationalsozialistischen Zwangsarbeitssystems entwickelte.
Seit 1938 war die Stadtreinigung zuständig für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Stadtentwässerung, Müllverbrennung (Borsigstraße/Kruppstraße – heute Ruhrstraße) sowie für Wartung und Betrieb der dafür eingesetzten Geräte und Fahrzeuge in ganz Hamburg. Organisatorisch war sie dem Tiefbauamt der Bauverwaltung (Baubehörde) unterstellt.

Erst 1944 wurde sie als eigenständige Behörde ausgegliedert und war fortan für den stadtweiten Einsatz von Zwangsarbeiter:innen im öffentlichen Bereich verantwortlich.
1939 verfügte die Stadtreinigung über insgesamt 1.586 Stellen, aufgeteilt auf folgende Bereiche:
Müllabfuhr 488 Stellen
Müllverbrennung 215 Stellen
Krafrwagenwerkstatt 80 Stellen
Straßenreinigung 803 Stellen
Zum 31. März 1939 waren in der gesamten Bauverwaltung 1.775 Beamte, 1.560 Angestellte und 6.208 Arbeiter beschäftigt – insgesamt 9.543 Personen. Die meisten Arbeitskräfte entfielen auf das Tiefbauamt (3.350) sowie den Strom- und Hafenbau (2.527).
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden viele Beschäftigte – auch aus der Stadtreinigung – zur Wehrmacht eingezogen oder in den Sicherheits- und Hilfsdienst (SHD) versetzt, der unter anderem für den Luftschutz zuständig war. So meldete die Stadtreinigung am 3. Oktober 1939, dass im Bereich Müllabfuhr 101 Männer zur Wehrmacht und 24 zum SHD versetzt worden waren. In der Müllverbrennung betraf dies 42 (Wehrmacht) und 5 (SHD), in der Straßenreinigung 115 (Wehrmacht) und 144 (SHD oder andere Dienste). Um den Personalmangel zu lindern, wurden 1939/1940 innerhalb der Baubehörde Versetzungen vorgenommen, etwa von 125 Hafenarbeitern der HHLA zur Müllabfuhr.
Erste Überlegungen zum Einsatz von Kriegsgefangenen bei der Stadtreinigung
In einer Besprechung vom 13. Juni 1940 zwischen der Bauverwaltung und der Hauptverwaltung der Stadt wurde erstmals über den möglichen Einsatz von Kriegsgefangenen bei der Stadtreinigung diskutiert. In einem Schreiben vom 21. Juni 1940 an die Stadtreinigung hieß es:
„Sollte es mit Rücksicht auf die Art der Arbeiten bei der Stadtreinigung nicht möglich sein, in dem notwendigen Umfang Kriegsgefangene dafür einzusetzen, dürfte zu prüfen sein, ob nicht durch die Einstellung solcher bei anderen Abteilungen der Bauverwaltung ein Kräfteausgleich zugunsten der Stadtreinigung herbeigeführt werden kann.“
Die Bauverwaltung antwortete am 23. Juli 1940, dass weder der Einsatz von Kriegsgefangenen noch ein interner Personaltransfer möglich sei, „da dort geeignete Schwerarbeiter für die Müllabfuhr nicht vorhanden sind.“
Erste ausländische Arbeitskräfte bei der Stadtreinigung ab August 1940
Unter dem Druck der Behördenleitung änderte das Tiefbauamt schließlich seine Haltung. Die Leitung der Baubehörde entschied, beim Arbeitsamt 150 ausländische Arbeitskräfte anzufordern – 100 für die Müllabfuhr, 50 für die Stadtentwässerung.
Am 7. und 9. August 1940 trafen die ersten 40 dänischen Arbeiter bei der Müllabfuhr ein. Die Deutsche Arbeitsfront (DAF) richtete für sie ein Gemeinschaftslager ein und übernahm auch die Verpflegung. Der Standort dieses ersten Lagers ist bislang unbekannt; es war für bis zu 200 Personen ausgelegt.

Die Nationalsozialisten entwickelten eine rassistische Hierarchie, die ihr Vorgehen in den besetzten Ländern bestimmte. Die Einteilung erfolgte nach der angeblichen „Rassennähe“ zum idealisierten „nordischen Typ“. Dänen galten während der Besatzungszeit als „germanisches Volk“ und somit als „rassisch verwandt“ mit den Deutschen. Bereits ab 1938/1939 arbeiteten vereinzelt dänische Arbeitskräfte in deutschen Betrieben. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Dänemark am 9. April 1940 forderte die deutsche Seite im Rahmen von Handelsverhandlungen gezielt dänische Arbeitskräfte für den Einsatz im Reich an. Am 24. Mai 1940 wurde in Kopenhagen die „Deutsche Arbeitsvermittlungsstelle“ eröffnet. Bis Ende Mai 1940 wurden rund 6.000 dänische Arbeiter nach Schleswig-Holstein, Hamburg, Cuxhaven und Bremerhaven vermittelt.
Aus 40 Dänen werden über 2.000 Zwangsarbeiter
Die Straßenreinigung und insbesondere die saisonale Schneebeseitigung waren ein weiterer Aufgabenbereich der Stadtreinigung, in dem die Behörde eigenständig Personal einsetzte. Wie bei der Müllabfuhr wurde auch hier zunehmend auf Kriegsgefangene zurückgegriffen. 1939 lag die durchschnittliche Beschäftigtenzahl bei etwa 800. Zur Schneebeseitigung wurde das Personal saisonal deutlich aufgestockt. Aufgrund des Kriegs und der damit verbundenen Personalengpässe wurden auch in diesem Bereich vermehrt Kriegsgefangene eingesetzt. Am 18. Februar 1942 arbeiteten 1.546 französische Kriegsgefangene bei der Stadtreinigung. Diese Männer gehörten verschiedenen Arbeitsbataillonen an, die in Kompanien unterteilt waren. Nach Ende des Schneedienstes reduzierte sich ihre Zahl auf etwa 700.
Neben dem direkten Einsatz von Zwangsarbeitern beauftragte die Stadtreinigung auch externe Unternehmen mit Trümmerräumung, Schutttransport, -verwertung und Abbrucharbeiten. Zwischen dem 20. August und dem 17. Oktober 1942 wurden von 500 verschleppten sowjetischen Männern direkt bei der Stadtreinigung (15) bzw. dem Tiefbauamt (22) eingesetzt. 300 von ihnen wurden auf 13 Bauunternehmen verteilt. Diese Zahlen beruhen auf einer Stichtagsauswertung aus dem April 1943.