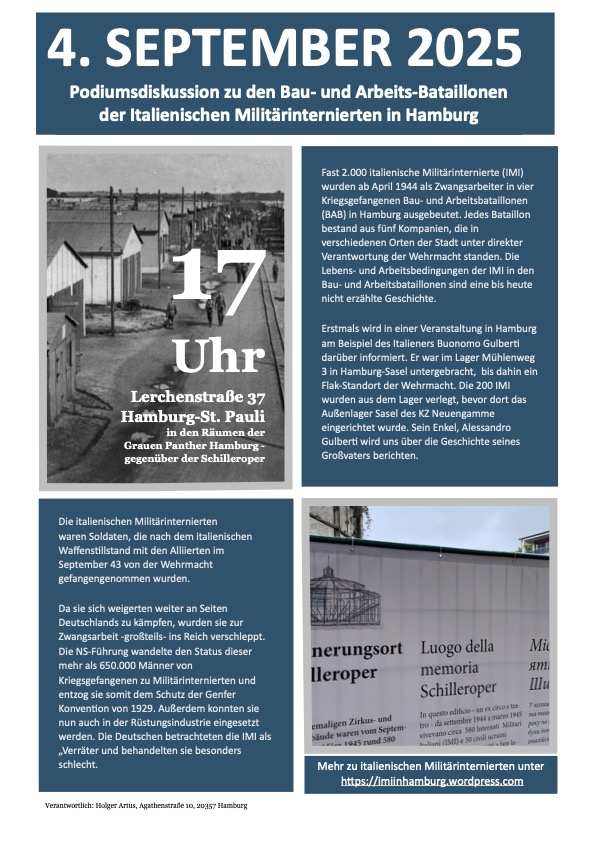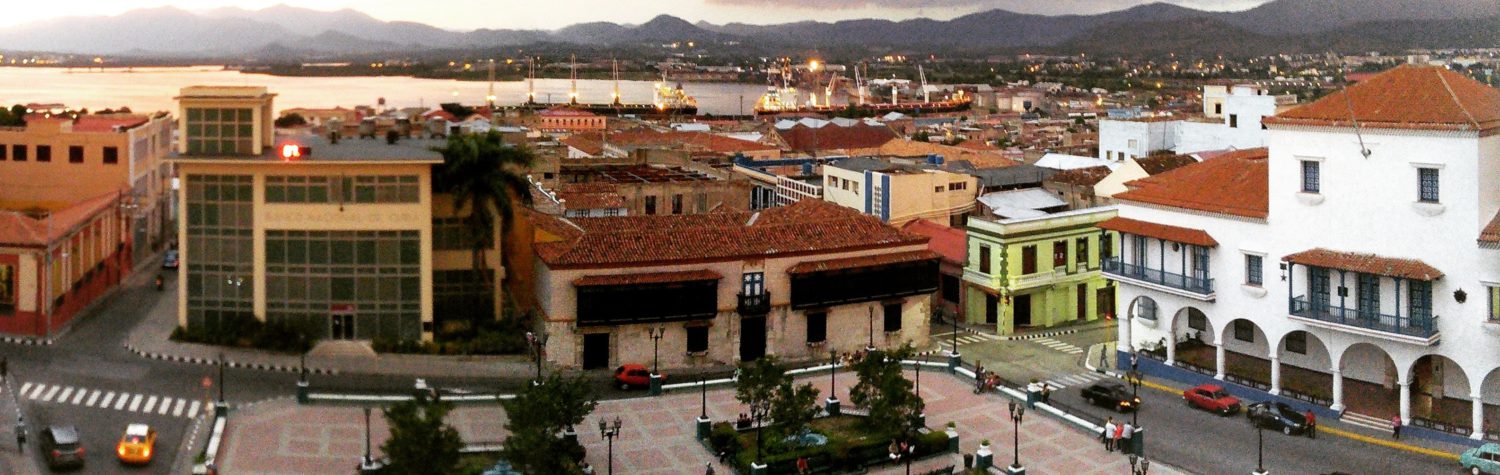Ein Thema, dass ich immer noch einmal im Zusammenhang mit den italienischen Militärinternierten angehen wollte. Dank einer Angehörigen können wir dazu am 4. September 2025 eine Veranstaltung anbieten.
Zwangsarbeit der italienischen Militärinternierten in den Kriegsgefangenen-Bau- und Arbeitsbataillonen der Wehrmacht in Hamburg
Im April 1944 wurden fast 2.000 italienische Militärinternierte (IMI)im Kriegsgefangenen Stammlager Sandbostel in vier KriegsgefangenenBau- und Arbeitsbataillone (BAB) eingeteilt, das BAB 196/197 und 201/202. Ab September 1944 wurden diese neustrukturiert und in die Landesbataillone 19 und 22 umbenannt. Unter dem Befehl der Wehrmacht wurden die IMI als Zwangsarbeiter im Hamburg und Umgebung eingesetzt.
Bei den “Militärinternierten” handelte es sich um italienische Soldaten, die von der Wehrmacht nach dem italienischen Waffenstillstand mit den Alliierten ab September 1943 gefangen genommen wurden. Viele dieser Soldaten hatten sich den Deutschen ergeben, andere waren desertiert und versuchten sich nach Hause durchzuschlagen, Teile der italienischen Armee hatten zunächst gegen die deutschen Truppen gekämpft. Nach ihrer Gefangennahme weigerten sie sich an Seiten Deutschlands zu kämpfen und wurden daraufhin zur Zwangsarbeit – meist- ins Reichsgebiet verschleppt. Die Deutschen betrachteten sie als „Verräter“, und die NS-Führung erklärte sie am 20. September 1943 zu „Militärinternierten. Durch diesen Entzug des Kriegsgefangenenstatus unterlagen sie nicht mehr den Schutzbestimmungen der Genfer Konvention von 1929, und auch ihr Einsatz in der Rüstungsindustrie war möglich. Die Deutschen behandelten die IMI in den Lagern und Betrieben besonders schlecht. Von den mehr als 600.000 italienischen Militärangehörigen, die Nein“ gesagt hatten, überlebten etwa 50.000-60.000 die Gefangenschaft nicht. Die ersten IMI aus dem Kriegsgefangenen Stammlager (Stalag) Sandbostel kamen am 23. September 1943 nach Hamburg. Von den großen Lagern wie dem Lagerhaus G am Dessauer Ufer bzw. Lagern der Hamburger Speicherstadt wurden sie auf dezentrale Lager, vor allem auf Hamburger Schulen und andere so genannte Gemeinschaftslager verteilt.
Schon ab Sommer 1940 wurden die ersten dieser Bataillone zur Zwangsarbeit eingesetzt. Ihr systematischer Einsatz erfolgte ab 1941/1942, um den sich drastisch verschärfenden Mangel an Arbeitskräften, bedingt durch den Abzug der deutschen Männer an die Front, auszugleichen. Im Stalag Sandbostel wurden im Kriegsverlauf zeitgleich bis zu 650 Arbeitskommandos zwischen Elbe und Weser verwaltet, dort arbeiteten sie zuerst in der Landwirtschaft.
Die zentrale Aufgabe der Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht bestand in der Bereitstellung von Arbeitskräften. Die Männer wurden zur Arbeit in der gesamten Kriegswirtschaft, in Landwirtschaft, Handwerk und in der Industrie, zum Teil auch in der Rüstungsproduktion herangezogen. Hierzu wurden sie in verschiedene sogenannte Arbeitskommandos eingeteilt und im ganzen Reich auf unzählige Arbeitslager verteilt. . Die BAB, die einem eigenen Befehlsstab unterstanden, wurden jeweils geschlossen an ihren verschiedenen Arbeitsorten eingesetzt: zum Bau kriegswichtiger Infrastruktur, zu Aufräumungs- und Instandsetzungsarbeiten nach Bombenangriffen sowie später auch zur Arbeit in verschiedenen Industriezweigen sowie und der Rüstungsproduktion. So waren in Hamburg im Winter 1942 zeitweilig 1.500 französische Kriegsgefangene zur Straßenreinigung und Schneebeseitigung eingesetzt.
Bis heute ist sind die Informationen über den Einsatzesvon Kriegsgefangenen als Zwangsarbeiter in Hamburg wegen fehlender Unterlagen bzw. deren mangelnder Erschließung sehr lückenhaft. Man kann zwar etwas über die einzelnen Bataillone, ihre Nummern, den Einsatzweck, die Anzahl der eingesetzte Zwangsarbeiter der einzelnen Bataillone sagen, weiß aber wenig über deren konkrete Arbeitseinsatzortund wo sie in der Stadt untergebracht waren. . So gab es in Hamburg ein Hafenbataillon, zu dem bis heute keine Informationen vorliegen.
Auch von den rund 2.000 IMI, die in den BAB arbeiten mussten, sind nur eine Handvoll Namen bekannt. Die beiden BAB waren in jeweils fünf Kompanie mit jeweils 200 IMI eingeteilt. Zu ihren Arbeitseinsatzorten und den Lager, in denen sie untergebracht waren, liegen nur wenig gesicherte Informationen vor. Gesichert sind -über 80 Jahre nach Kriegsende- nur zwei Standorte: der „Celler Hof“ in Hamburg-Langenbek und der Standort im Mühlenweg 3 in Hamburg-Sasel, ein Lager, in dem die IMI untergebracht waren, bevor dort das Außenlager Sasel des KZ Neuengamme errichtet wurde. Es gibt zwar noch verschiedene Vermutungen zu weiteren Lagerstandorten und Arbeitskommandos der BAB-Kompanien, aber bislang keine gesicherten Nachweise.
Es laden ein: Projektgruppe italienische Militärinternierte, St.Pauli Archiv,