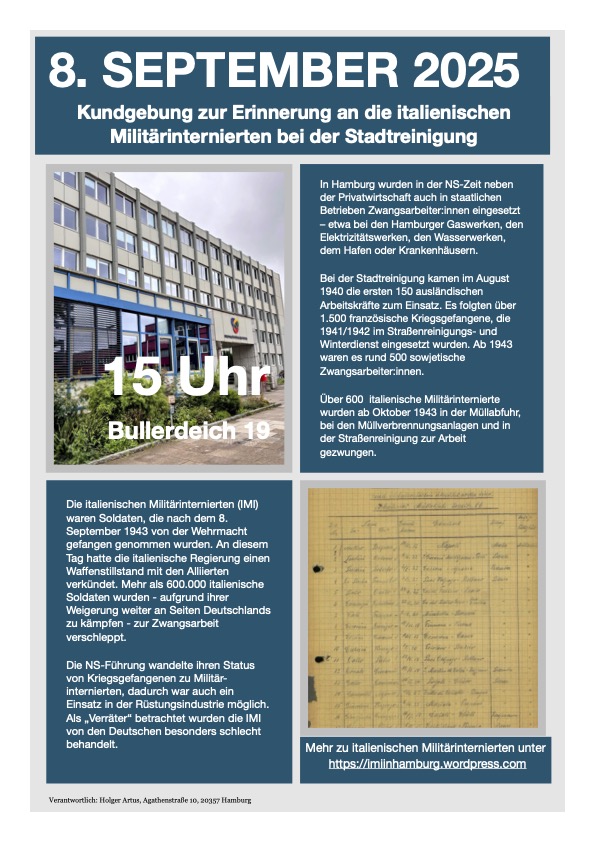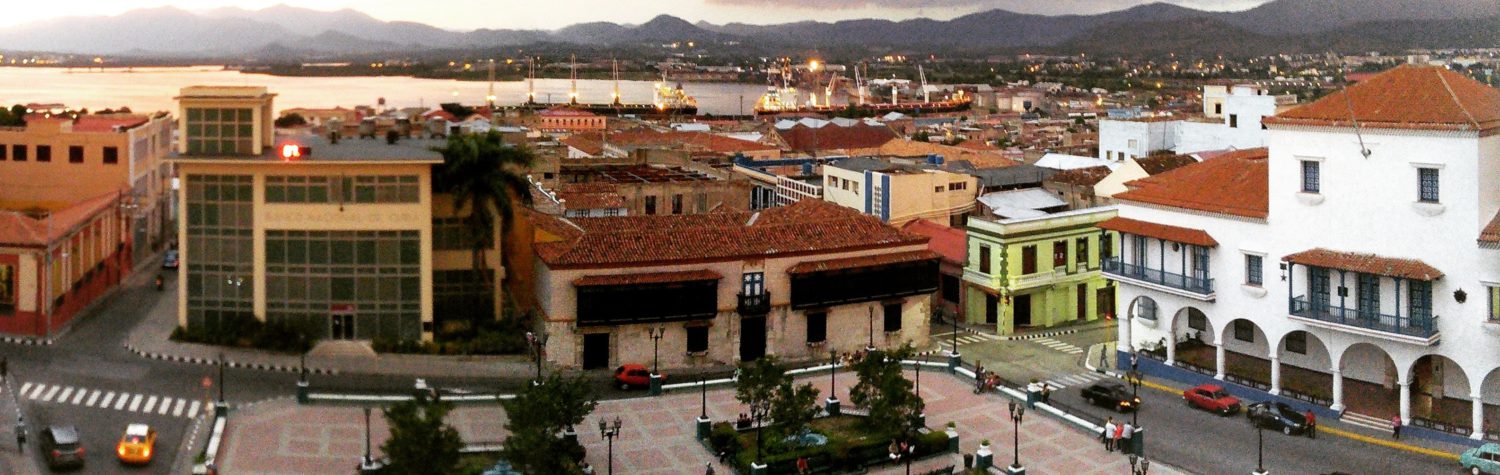Am 8. September 2025 findet zur Erinnerung an die italienischen Militärinternierten bei einem öffentlichen Unternehmen, der Stadtreinigung, eine Kundgebung statt. Das Unternehmen wie am Beispiel von Hamburg Wasser Haltung und hat seinen Platz bestimmt, wie es mit der NS-Geschichte umgeht.
Es soll vor dem Verwaltungsbebäude eine Erinnerungstafel an die Menschen aufgestellt werden, die als Zwangsarbeiter Opfer des NS-Systems worden. Ich bin sehr angetan von der Gesamthaltung des Unternehmens. Hier wurde Wort gehalten, wenn ich mich an die ersten Gespräche erinnere. Dazu gibt es einen Aufruf, mit dem nur virtuell geworben wird. Jeder der Texte, den wir in den vergangenen sechs Jahren zum 8. September 1943 verbreitet haben, spielt(e) immer einen Stand unsere Debatte wieder.
Auch wenn es Geschichte ist – das Leben der Zwangsarbeiter in der Stadtreinigung während der NS-Zeit soll nicht vergessen werden
Am 8. September 2025 wird vor dem Hauptgebäude der Stadtreinigung am Bullerdeich 19 mit einer Kundgebung an all die Menschen erinnert, die in der NS-Zeit von 1940 bis 1945 als Zwangsarbeiter:innen für die Stadtreinigung Hamburg eingesetzt wurden. Vertreter:innen der Stadtreinigung, aus Italien und Frankreich sowie aus der Zivilgesellschaft werden bei der Veranstaltung sprechen. Im Anschluss an die Kundgebung wird eine Gedenktafel der Öffentlichkeit übergeben.
Zwischen 1939 und 1945 wurden in Hamburg insgesamt etwa 500.000 Menschen aus den von Deutschland besetzten Ländern als Zwangsarbeiter:innen eingesetzt, Männer, Frauen und Kinder. Ohne sie wäre das wirtschaftliche und öffentliche Leben der Stadt zusammengebrochen. Sie mussten in mehr als 1.200 Unternehmen sowie direkt für die Stadt Hamburg arbeiten. Zehntausende von ihnen waren in der Rüstungsindustrie tätig. Täglich sahen die Hamburger:innen diese Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Die Zwangsarbeit war überall sichtbar – sie war das wohl offensichtlichste NS-Verbrechen. Fast niemand konnte später glaubhaft sagen: Davon habe ich nichts gewusst.
Auch in den Betrieben der Stadt Hamburg waren Tausende Zwangsarbeiter:innen tätig – insbesondere im Hafen, etwa beim GHB oder bei Strom- und Hafenbau (heute HPA). Aber auch in der öffentlichen Daseinsvorsorge im Gesundheitswesen, bei den Hamburger Gaswerken (HGW), den Hamburgischen Electricitäts-Werken (HEW), den Hamburger Wasserwerken (HWW) oder der Hamburger Hochbahn (HHA).
Nach heutigen Erkenntnissen waren bei der Stadtreinigung Hamburg mehr als 2.500 Zwangsarbeiter:innen in wechselnden Zeitabschnitten eingesetzt. Sie arbeiteten vor allem bei der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, der Schneebeseitigung sowie in den Müllverbrennungsanlagen in der Borsigstraße und der Ruhrstraße 49. Ihre Arbeitsorte waren die Straßen der Stadt. Aus den Zwangsarbeitslagern wurden sie zu den 52 damaligen Lager- und Betriebshöfen bzw. -plätzen gebracht. Die ersten Zwangsarbeiter kamen am 6. August 1940 zur Müllabfuhr – aus Ländern, die zuvor von der Wehrmacht überfallen worden waren. Allein zur Schneebeseitigung wurden im Winter 1942 bis zu 1.500 französische Zwangsarbeiter eingesetzt.
Ab 1943 wurden auch sowjetische Zwangsarbeiter:innen für die Trümmerbeseitigung direkt bei der Stadtreinigung eingesetzt – ihre Zahl wuchs bis Ende 1944 auf fast 500 Menschen. Ab September/Oktober 1943 arbeiteten zudem 629 italienische Militärinternierte unter Bewachung der Wehrmacht bei Müllabfuhr und Straßenreinigung. Im weiteren Kriegsverlauf wurden rund 300 von ihnen direkt bei der Trümmerbeseitigung eingesetzt. Ihre Lager befanden sich unter anderem auf der Trabrennbahn Farmsen, den Schulen Wendenstraße/Sorbenstraße in der Schilleroper in St. Pauli, in der Moortwiete in Altona oder der Moorweidenstraße nahe der Universität.
Bei den italienischen Militärinternierten handelte es sich um Soldaten, die nach dem Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten im September 1943 von der Wehrmacht gefangen genommen wurden. Etwa 650.000 von ihnen verweigerten den weiteren Kampf an der Seite der deutschen Armee. Zur Umgehung der Genfer Konventionen erklärte die NS-Führung sie am 20. September 1943 von Kriegsgefangenen zu „Militärinternierten“ – und verschleppte sie zur Zwangsarbeit, meist ins Reichsgebiet. Eine Entschädigung wurde den Männern aus Italien verweigert. Auch eine über 20 Jahre andauernde juristische Auseinandersetzung, in der italienische Gerichte ihnen eine Entschädigung zusprach, konnte daran nichts ändern: Die deutsche Seite verweigerte sich.
Die Gedenktafel am Bullerdeich 19 soll an all jene Zwangsarbeiter:innen erinnern, die aus ihrer Heimat verschleppt und bei der Stadtreinigung Hamburg eingesetzt wurden. In ganz Hamburg finden sich mittlerweile zahlreiche solcher Gedenkorte. Sie sind Mahnmale zur Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten und ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Faschismus in der deutschen Gesellschaft. Sie sind auch ein Zeichen der Hoffnung – dass Hass und Hetze keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.