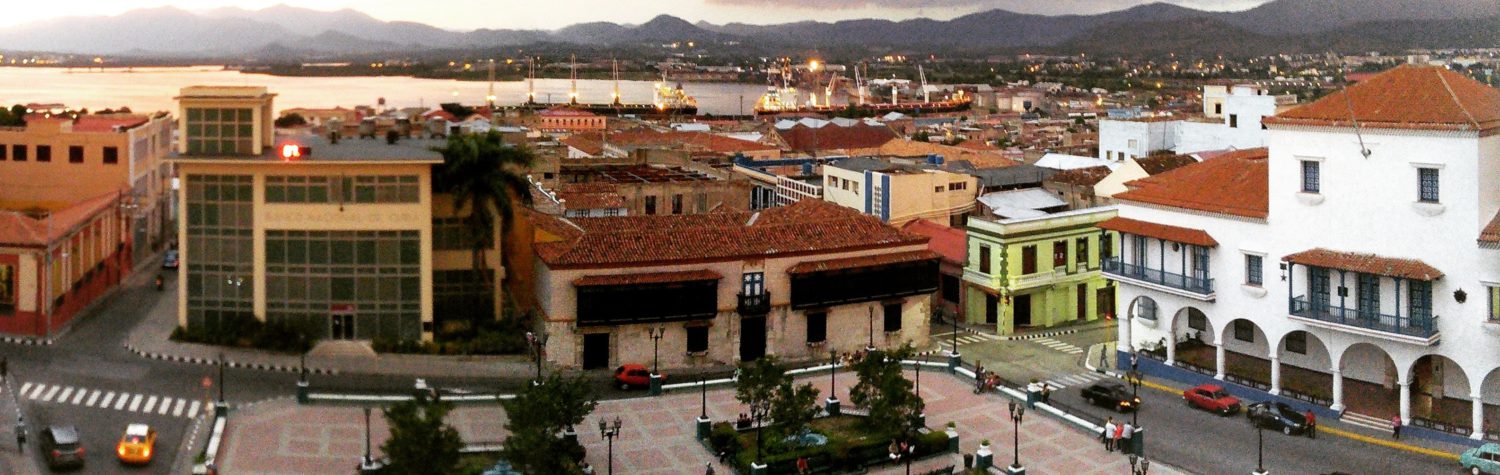Vor 25 Jahren kaufte Frank Otto zusammen mit Hans Barlach die MOPO. Zum 31. Oktober 1999 wurden sie Eigentümer. Eine Wende für die Belegschaft und die Zeitung. Endlich war die Periode von G+J zu Ende. Die MOPO bekam unter Frank Otto ihre größte Chance nach ihrer Gründung 1949. Ohne Frank und sein Management wäre die MOPO vom Markt verschwunden. Er war gewissermaßen unser Retter.
Am 1. November 1999 erschien die Hamburger Morgenpost (MOPO) mit einer besonderen Ausgabe. Die neuen Eigentümer, Frank Otto und Hans Barlach, waren auf dem Titelblatt zu sehen – ein starkes Zeichen für den Neuanfang der Zeitung. Nach über 30 Jahren wirtschaftlicher Probleme und sinkender Glaubwürdigkeit sicherte diese Übernahme die Existenz der MOPO und leitete eine Phase der finanziellen Erholung ein. Seit den späten 1960er Jahren hatte die Zeitung Verluste eingefahren, doch unter der Führung von Frank Otto (mit einem Anteil von zwei Dritteln) und Hans Barlach (ein Drittel) begann ein Jahrzehnt des Aufschwungs.
Frank Otto und sein Team konzentrierten sich darauf, die Zeitung auf Hamburg auszurichten und sanft zu restrukturieren, ohne die Belegschaft zu gefährden. Das Management wurde verschlankt, und der Digitalisierungsprozess wurde mit einem Fokus auf nachhaltigen Nutzen für das Unternehmen und nicht für Konzerninteressen oder persönliche Karriereziele vorangetrieben. Unter Ottos Führung gab es eine klare Linie in der Entscheidungsfindung und eine Innovationsfreude.
Neuausrichtung unter neuer Leitung
Besonders wichtig für die finanzielle Erholung war die Loslösung vom Konzern Gruner + Jahr. Redaktionell sorgte die Ära unter Wieland Sandmann und Josef Depenbrock für Chaos sorgte. Die Chefredaktion hatte keine ernsthaften Rückhalt in der Redaktion. Die Karriereleiter zu Gruner + Jahr war für diejenigen, die in diesen Kategorien ihre Leben planten, nicht mehr gegeben. In der MOPO waren die Aufstiegschancen gering. Marcus Ippisch, der damalige Geschäftsführer und Roger Frach, der kaufmännische Leiter – die aus den beiden Lagern der Eigentümer kamen – stellten die richtigen Fragen mit Blick auf die Relevanz der Zeitung für die Hamburger:innen, aber der Chefredakteur Depenbrock war eher nicht zu gewinnen. Er war gewissermaßen nur an der Kohle als Mitgesellschafter interessiert. Zu Beginn war der finanzielle Druck auf ihn aus anderen Geschäften noch groß. Er besorgte sich einen Kredit über die MOPO. Später erlebte, wie eine beziehungsstärke Redaktion sich trotz dieser Rahmenbedingungen souverän selbst organisierte und einen Weg fand, Depenbrock ins Boot zu holen.
Mit Frank Ottos Management begann eine solide Sanierungsphase. Trotz interner Konflikte unter den Eigentümern waren die Ergebnisse stabil, und das Niveau der Berichterstattung steigerte sich im Vergleich zur G+J-Periode deutlich.
Die Lage vor der Übernahme: Krise unter Gruner + Jahr
Die Jahre unter G+J – besonders die Ära unter Mathias Döpfner ab 1996 – erwiesen sich als problematisch für die MOPO. Döpfner veränderte die Zeitung optisch und inhaltlich versuchte er, eine Rechtswende in der Berichterstattung durchzusetzen, die in der Redaktion und der Stadt auf Ablehnung stieß. Eine sechsköpfige Chefredaktion war ein Ausdruck, um was es ihnen unter Döpfer ging – mlglichst viel Geld. Trotz hoher Investitionen von Gruner + Jahr kam der erwartete Erfolg nicht, und die Verluste der Zeitung wuchsen weiter. Sie mündeten unter Döpfner am Ende im zweistelligen Millionen-Bereich.
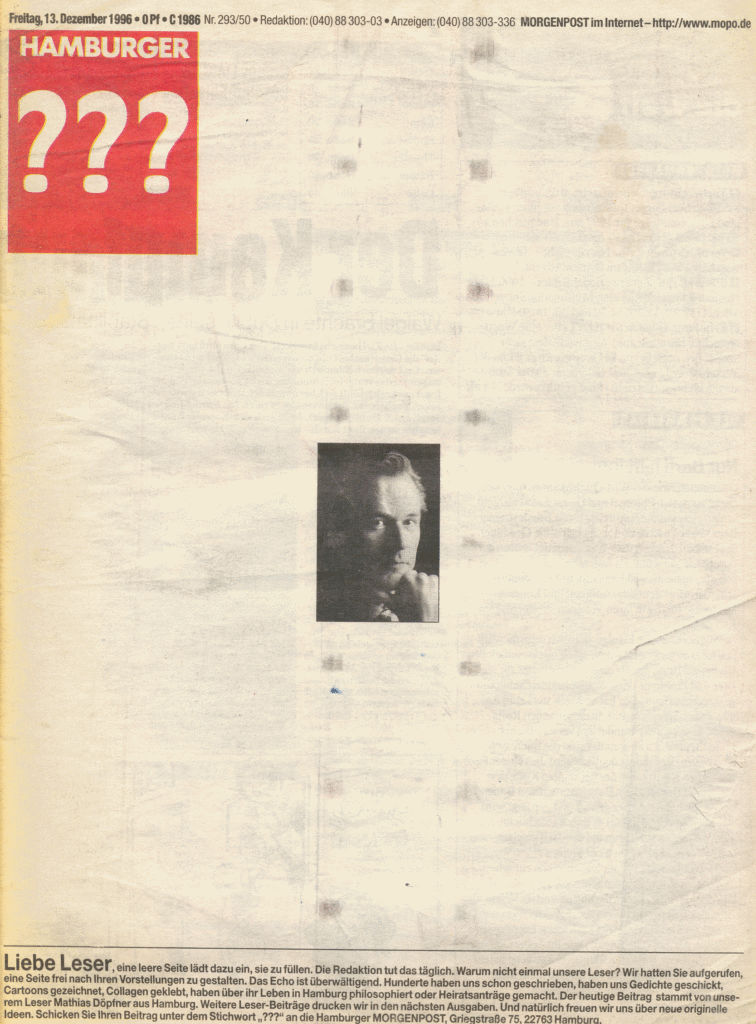
Die Sanierungsphase nach Döpfner
Mit Marion Horn als neue Chefredakteurin (1998) kehrte Ruhe in die Redaktion ein, und das Engagement für fundierte Berichterstattung kehrte zurück. Es begann ein redaktioneller Aufschwung, der die MOPO wieder näher an die Leser brachte und die Ausrichtung auf Hamburg stärkte. Die spätere G+J-Redaktionsgemeinschaft zwischen dem Express, dem Berliner Kurier und der MOPO, die unter G+J initiiert wurde, stellte sich als Fehlentscheidung heraus. Es war klar, dass es die letzte Runde der MOPO unter G+J war. Für Marion Horn tat es mir leid, weil sie zu uns passte. Ihrer Karriere hat es nicht geschadet.
Der Betriebsrat war in dieser Zeit aktiv und bereitete sich auf eine mögliche Krise vor, die dann jedoch durch den Verkauf abgewendet werden konnte.
Der Verkauf und die ersten Reaktionen
Als der Verkauf am 21. Oktober 1999 verkündet wurde, erfuhr ich die Nachricht per Pager im Kino. Nach einem Telefonat ging es sofort nach Bahrenfeld zur Unternehmensversammlung. Dort nutzte ich die Gelegenheit, um vor versammelter Mannschaft den Abschied von G+J symbolisch mit den Worten zu kommentieren: „Endlich sind wir euch los!“ , verbunden mit einer sehr abfälligen Handbewegung. Es folgte eine „öffentliche“ Betriebsratssitzung, wo wir das Hausrecht hatten. Mit dieser öffentlichen Sitzung – so war unsere Planung – boten wir der Redaktion das Plenum an, um unmittelbar über das weitere Vorgehen zu beraten. Es folgten später noch weitere dieser “öffentlichen” BR-Sitzungen, an der auch die Chefredaktion teilnahm, da wir die gleichen Interessen hatten. Wir hatten diese Form bereits vorher wiederholt ausprobiert und ich erinnere mich, wie ich damals Mathias Döpfner aus dem Raum geschmissen hatte.
Die Reaktion der Belegschaft am 21. Oktober 1999 vor dem Gebäude zeigte eine gemischte Stimmung – große Enttäuschung und Angst, was künftig aus den Arbeitsplätzen wird. Das Treffen vor der Tür war auch ein Angebot an die Belegschaft, dass wir handelnd reagieren, um das Vertrauen in die eigene Kraft zu erhöhen. Wir hatten der Form nach damals zu einer öffentlichen Pressekonferenz geladen, an der die Belegschaft teilgenommen hatte.
Eine unserer Erzählungen war, dass die Gesellschafter kommen und gehen, die Kontinuität der Zeit wird über die Menschen aus dem Unternehmen hergestellt. Der Betriebsrat stand für die soziale Kontinuität und Beschäftigungssicherung. Das ist uns vollständig über eine lange Periode gelungen.
Wenn ich heute die vertraulichen Ordner über die Verkaufsverhandlungen ansehe, so schaue ich mit einer gewissen Zufriedenheit auf unser Vorgehen als Interessenvertretung. Zum damaligen Zeitpunkt kannte ich sie vor allem aus den Briefings der Medienkollegen:in. Gut erinnere ich mich an wiederkehrende Debatten mit den Gewerkschaften, dass man nicht „spekulieren“ solle, was passieren könnte, sondern das faktische abwarten sollte. Mir saß die Herangehensweise der IG Medien zum Verkauf von Greif an G+J 1986 noch im Nacken. Diese unselbständige und nicht an Beschäftigte ausgerichtete Haltung war nicht meine Position. Bis heute bin ich froh darüber, da wir uns eingemischt haben. Wir hatten nicht spekuliert, sondern Annahmen an Hand von Kriterien formuliert und diese ständig überprüft. Dabei stützen wir uns auf unser nachrichtliches Informationssystem.