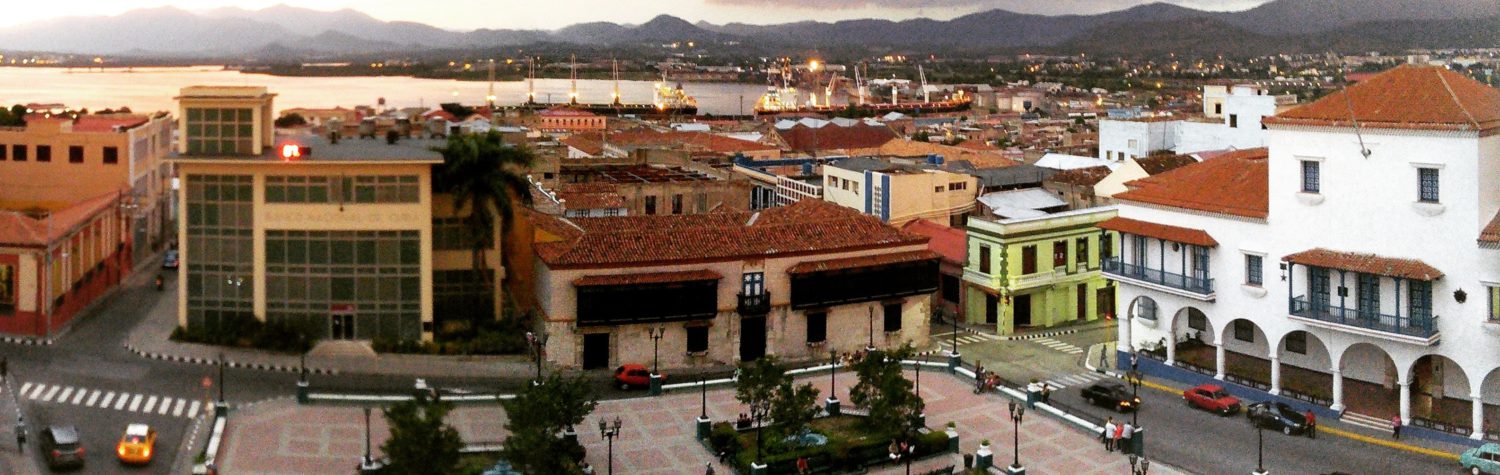Nach dem Kauf der Hamburger Morgenpost im Januar 2006 durch einen Finanzinvestor hatte ich einen Artikel für die UZ, Wochenzeitung der DKP, geschrieben.
Ich war seit einigen Jahren wieder Mitglied, habe aber in dem Verein nichts mehr gemacht. Wenn man mich fragte, wollte ich jedoch nicht nein sagen, später bin ich ausgetreten. Die Abenteuerlichkeit war für mich nicht mehr zu ertragen.
Den Text für die UZ habe zufällig auf meinem Rechner im September 2025 gefunden. Ich weiß nicht, ob er damals erschienen ist, gehe aber davon aus.
Den Text habe ich am 10. Februar 2006 abgeschickt. Die MOPO war am 27. Januar 2006 gekauft worden. Es war gerade einmal zwei Wochen her, in denen ich mich zu den neuen Akteuren im deutschen Zeitungsmarkt positioniert hatte. Daraus ergaben sich noch weitere Papiere und Projekte. Mir ging es nicht ums Schreiben, ich war in der Situation, organisiert die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. Nicht als Laberkopf, sondern mit dem Blick , wirksam im Ergebnis mit den Menschen zu handeln (20. September 2025).
Nach dem Erwerb der Berliner Verlagsgruppe ist den beiden Finanzinvestoren VSS und Mecom gelungen, eine weitere deutsche Zeitungs zu akquieren. Ende Januar 2006 wurde die älteste deutsche Boulevard-Zeitung, die Hamburger Morgenpost, gekauft. Bereits anlässlich des Kaufs der Berliner Verlagsgruppe im Oktober 2005 von G+J/Holtzbrinck wurde von den neuen Gesellschafter erklärt, dass sie in dem Erwerb die Chance für ihren Wachstum im deutschen und europäischen Zeiungsmarkt sehen. Mit dem Kauf der Berliner Verlagsgruppe ist erstmals in der deutschen Zeitungswirtschaft der Markteinstieg in größerem Umfang in den Zeitungsmarkt gelungen. Doch trotz alle erklärten Euphorie durch die beiden Finanzinvestoren darf man den Einstieg und die Außenerklärungen nicht überbewerten. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es im großen Zuge gelingt, in den deutschen Zeitungsmarkt einzusteigen. In Markt ist durchaus bekannt, welche Zeitungsverlage mittelfristig übernahme-Kandidaten werden könnten bzw. wo bereits durch die Eigentümer signalisiert wurde, dass die verkaufen wollen. Da nach überstandener Anzeigenrezession alle großen Verlagsgruppen auf Wachstum durch Aufkauf sind, ist es eine Frage des Preises, den die Finanzinvestoren bereit sind zu zahlen. Da die großen Zeitungsverlagsgruppe über umfassende Strukturen und Erfahrungen verfügen, ist es ihnen leichter, Marktfremden den Zutritt zu erschweren.
Kauf von Berliner Zeitung, Berliner Kurier und Hamburger Morgenpost Ergebnis einer Sondersituation
Der Erwerb der Hamburger Morgenpost wie der Berliner Verlagsgruppe sind einer Sondersituation geschuldet. Der Berliner Verlag mit seinen beiden Zeitungstitel Berliner Zeitung (Auflage 185.000) und Berliner Kurier (Auflage 125.000), dem Anzeigenblatt Berliner Auflage (verteilte Auflage 1,2 Mio), dem Berliner Stadtmagazin TIP und der Zeitungsdruckerei waren 2001 von Gruner+Jahr an die Verlagsgruppe Holtzbrinck (ZEIT, Tagesspiegel, Handelsblatt, Saarbrücker Zeitung u.a.) verkauft worden. Am Ende scheiterte die Übernahme am Kartellrecht, so dass Holtzbrinck den Weg zwischen Weiterverkauf oder rechtlichen Streit wählen musste. Der Verkauf brachte 160 Mio, € Liquidität in die Verlagsgruppe, so dass den Herren eine Trennung nicht so schwer gefallen war. Der Erwerb der Hamburger Morgenpost, ebenfalls eine ehemalige G+J-Zeitung (1986 – 1999) von Hans Barlach war nur eine Frage des Zeitpunkts und notwendiger Liquidität.
Fragwürdige Haltung der Journalistenorganisation DJV
Zur Überraschung vieler aufgeschlossener Medienkritiker erklärte der DJV anlässlich des Kaufs der MOPO, dass ausländische Unternehmen am deutschen Zeitungsmarkt keinen herrschenden Einfluss erringen dürfen und dass die Beteiligungsverhältnisse von 49 % nicht überschritten werden. Das Hauptmotiv dürfte dabei weniger eine generelle Haltung sein, denn anlässlich des Kaufs von ProSiebensat1 AG oder Premiere aus der Insolvenzmasse des ehemaligen Kirch-Imperiums durch internationale Finanzinvestoren waren derartige Erklärungen nicht zu hören. Die Tatsache, dass der englische Zeitungsverleger David Montgomery einer der Erwerber der Zeitungen geworden ist, sowie Gespräche zwischen David Montgomery und dem DJV Ende 2005 dürften der Grund dafür gewesen sein. Wenigstens lässt sich diese m.E. fragwürdige Haltung anders nicht erklären.
Internationales Wachstum wird der wahrscheinliche Weg der Finanzinvestoren sein
Die Tatsache, dass Finanzinvestoren in der europäischen und auch deutschen Medienwirtschaft eine Rolle spielen, ist nichts Neues. Neben ProSiebenSat1 oder Premiere wurde 2003 einer der größten Fachverlage von Bertelsmann an PE-Unternehmen für 750 Mio. € gekauft, in der (deutschen) Druckindustrie sind PE-UNternehmen durchaus üblich. Im deutschen Zeitungsmarkt ein große und profitable Stellung zu erreichen, ist zum einen nur schwer möglich, da Marktführer keine Grund des Verkaufs sehen und zum anderen ein Markteinstieg bei Unternehmen eher möglich ist, wo es problematischen Erbfolgen oder gar Gesellschafterstreit gibt.
Ob die Wachstumsstrategie der beiden Finanzinvestoren im deutschen Zeitungsmarkt aufgeht, ist fraglich. Die größten Bewegungen in den letzten Jahren im Zeitungsmarkt war der Einstieg der Medien-Union mit rund 20 % in die Süddeutsche Zeitung und eine Rettungsaktivität bei der Frankfurter Rundschau durch die SPD-Medienholding DDVG. Beide Gesellschaften hatten erhebliche finanzielle Probleme und bei der FR waren die Großen schon dabei, sie zu erwürgen und damit reif für die Übernahme machen. Wie angekündigt, will die DDVG aber aus der FR in 2006 wieder aussteigen und ihre Anteile verkaufen. Die Versuch der Verlagsgruppe Holtzbrinck (Handelsblatt, Tagesspielge, ZEIT, Saarbrücker Zeitungen u.a.m), durch den Aufkauf des Berliner Verlages (2001) und der Rheinzeitung (2004) zu wachsen, scheiterten am Kartellrecht. Im Ergebnis trennte sich Holtzbrinck von der 2001 von der Berliner Verlagsgruppe und verkaufte an die Finanzinvestoren um VSS und Mecom. Es ist bezeichnend für die Bewegung am Zeitungsmarkt, dass sowohl der Berliner Verlag und die Hamburger Morgenpost aus dem Portfolio von G+J (Stern, Capital, Brigitte, Geo u.a.) stammen. Der Medienkonzern hatte sich 1999 grundsätzlich entschieden , sich von seinen Zeitungsaktivitäten zu trennen.Lediglich die deutsche FTD, ein Joint Venture mit dem englisch Zeitungskonzern Pearson (Financial Times). Diese Bereich wurde seit 1999 zum Verkauf angeboten. Jetzt sind zwei Standorte, Berlin und Hamburg nach mehreren Jahren Umweg wieder unter einem Dach einer neuen Gruppe. Noch nicht verkauft hat +J die Sächsische Zeitung, eine der größten deutschen Regionalzeitungen. Trotz aller Dementis durch die Finanzinvestoren wird der G+J-Zeitungsstandort in Dresden nicht zuletzt aus dieser Zugehörig- und Trennungsabsicht immer noch als möglicher Übernahmekandidat gehandelt. Sollte dieser Fall eintreten, so ist am Markt über Jahre verteilt eine Aktivität von einer Gruppe zur nächsten geschoben worden.
Bereits mit der Ankündigung nach dem Kauf des Berliner Verlages sagten die Finanzinvestoren, sie wollen im Zeitungsmarkt weiter wachsen. Schnell wurden die üblichen Verdächtigen in den Medien gehandelt. Es handelt sich dabei aber fast immer um die gleichen Verdächtigen. Vermutlich können es die dortigen Manager nicht mehr ertragen. So stehen bei der Braunschweiger Zeitung 20% der Anteile zur Disposition wie der Verleger der Rheinzeitung seine Aktivität vor einiger Zeit verkaufen wollte. Sowohl die Zeitungsverleger wie die erfahrenen Finanzinvestoren wissen, dass man in Unternehmen einsteigen kann, es eine Krise geben muss (z.B. Frankfurter Rundschau), es einen Strategiewechsel gibt (wie am Beispiel G+J) oder es Erbstreitigkeiten bzw. eine ungeklärte Nachfolge gibt. Die beiden Erwerberfonds haben sich in ihrer jetzigen Aktivität nicht auf die Finanzierung von neue Unternehmen konzentriert. Sie wollen gesunden und sanierte Unternehmen kaufen. Damit treten sie aber in einen Wettbewerb mit den großen Zeitungsverlagen, wie eben WAZ, Axel Springer, Holtzbrink, Ippen, Süddeutsche, Madsack oder dem Zeitschriftenkonzern Bauer, der ebenfalls im Zeitungsmarkt durch Aufkauf wachsen will. Ob die Finanzinvestoren bei den begehrten Titeln am Markt preislich mithalten ist fraglich. Wo die Grenzen de beiden Fonds in diesem Preis- und Bieterwettbewern sind, zeigt der englisch Markt. Hier sollte die Northcliffe Gruppe für 1,5 mrd. Englisch Pfund veräußert werden. Mecom und VSS können da nach Medienberichten nicht mithalten. Am Ende hängt es von der Strategie der Verkäufer ab, wo die Reise mitgeht. Verspricht der sich davon strategische Vorteile, spielt der Preis nur eine begrenzte Rolle. Keine Wunder, dass man am Markt noch nicht ganz von der These abgehen will, dass er Verkauf des Berliner Verlages an die Finanzinvestoren nur eine Deal mit der Verlagsgruppe Holtzbrinck ist, um das Kartellrecht aktuell zu umgehen und die hoffen, dass es hier zu Änderungen kommt, so dass man dann später ungestört wachsen kann.
Gewerkschaftliche Herausforderungen
Für das Herangehen der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung kann es nur bedeuten, sich auf Veränderungen einzustellen. Einstellen heißt, dass man in den kommenden Jahrzehnten mit Veränderungen am Zeitungsmarkt rechnen muss, die kleineren Zeitungsverlage werden bei schwierigen finanziellen Situationen das eine oder andere Mal in Schwanken kommen. Die großen Gruppen stehen zur Disposition, wenn es eine Strategiewechsel gibt.Aufkauf bedeutet, dass es eine neue oder korrigierte Geschäftsstrategie gibt, Synergien zwischen erworbenen Titeln bzw. den Verlagsabteilungen sind wahrscheinlich, sprich Arbeitsplätze sind betroffen. Zu verhindern, dass es keine Konkurrenz zwischen den Interessenvertretungen der aufkaufenden und aufgekauften Unternehmen gibt, ist der erste Schritt. Die Betriebsräte des Berliner Verlages wie der MOPO haben unmittelbar nach Bekanntwerden des Geschäfts erklärt, dass man sich auf die Zusammenarbeit freut – schließlich war man fast ein Jahrzehnt im Konzernbetriebsrat von Gruner+Jahr.